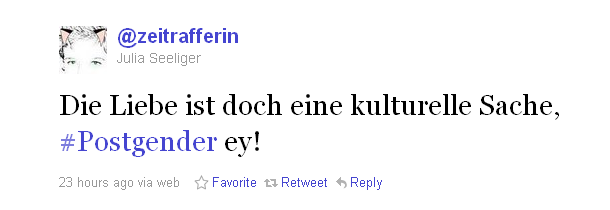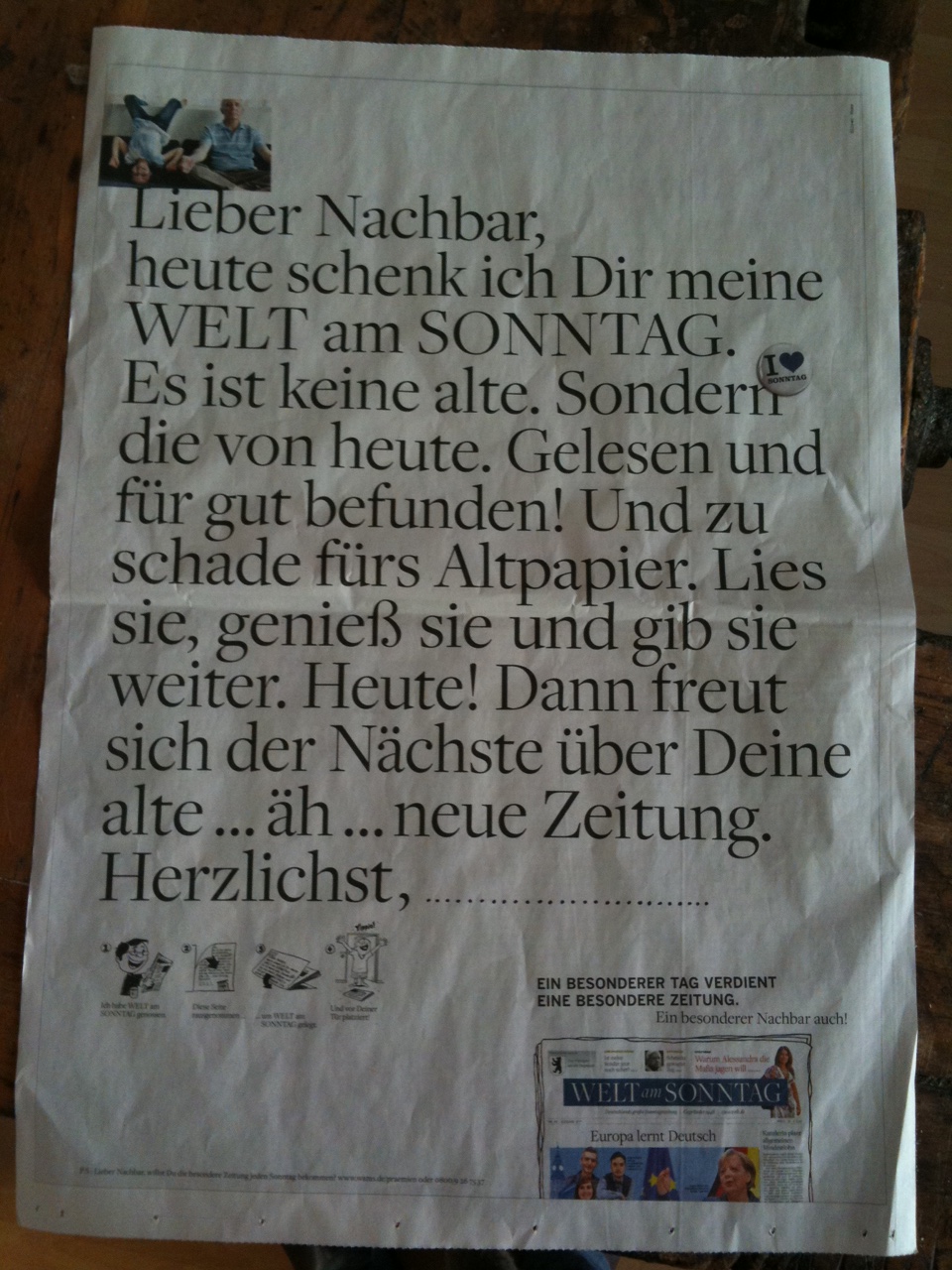|
|
Du, König, sahst, und siehe, ein großes und hohes und sehr glänzendes Bild stand vor dir, das war schrecklich anzusehen. Des Bildes Haupt war von feinem Golde, seine Brust und Arme waren von Silber, sein Bauch und seine Lenden waren von Erz, seine Schenkel waren Eisen, seine Füße waren eines Teils Eisen und eines Teils Ton. 34 Solches sahst du, bis daß ein Stein herabgerissen ward ohne Hände; der schlug das Bild an seine Füße, die Eisen und Ton waren, und zermalmte sie. Da wurden miteinander zermalmt das Eisen, Ton, Erz, Silber und Gold und wurden wie eine Spreu auf der Sommertenne, und der Wind verwehte sie, daß man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, ward ein großer Berg, daß er die ganze Welt füllte. |
| Daniel interpretiert die Vision Nebukadnezars. Die kolossale Statue symbolisiert den Ablauf der Geschichte, beginnend in einem ‘goldenen Zeitalter’, dem Paradies, sich Epoche für Epoche verschlechternd. Bis zu einem messianischen Ereignis – der Weltrevolution, die am Ende dieses ‘historischen Materialismus’ steht. |
|
Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind; als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild; dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin.1. Kor 13
.והיית אך שמח Devarim 16,15
Dass sich Stunden, Tage oder Wochen wiederholen, ist eine nützliche Illusion. In Wirklichkeit erleben wir jeden Moment unseres Lebens nur einmal; danach ist er vergangen. Was wir über gewisse Zeiträume unseres Lebens als relativ gleichförmig erleben, sind wir selbst. Wir haben von uns den Eindruck von Einheit, davon, dass wir eine Person sind, und zwar jeden Tag mehr oder weniger dieselbe.
Über lange Zeiträume hinweg verändert sich unsere Person allerdings, und zwar nicht gleichmäßig, sondern zu bestimmten Zeiten unseres Lebens sehr schnell, während sie dann wieder über Jahre und Jahrzehnte nahezu konstant zu sein scheint. Es ist keine völlig willkürliche Festlegung, unser Leben in Abschnitte zu unterteilen: in Kindheit, Jugend, Erwachsenenalter, Greisenalter – oder Ähnliches.
Romano Guardini (1885-1968) hat über die Lebensalter, Ihre ethische und pädagogische Bedeutung ein ganz bemerkenswertes Buch geschrieben, dessen Gedanken ich hier weiterspinne. Jedem der Altersabschnitte liegen ganz bestimmte Bedürfnisse, Fähigkeiten und Antriebe zugrunde. Aus der Notwendigkeit, diese Bedürfnisse zu befriedigen, die Fähigkeiten dem Lebensalter gemäß zu entwickeln und den Antrieben zu folgen, ergibt sich für jede Phase des Lebens eine spezifische Ethik – was für Kinder gut und wichtig ist, muss für den erwachsenen Menschen noch lange nicht immer noch recht sein.
Alles hat seine Zeit, und ein jegliches hat seine Stunde, wie Kohelet sagt. Dieses Konzept vom zielgerichteten, voranschreitenden Leben, ist typisch für unser jüdisch-christliches Weltbild; der Tod ist der Punkt, an dem das Leben abgeschlossen ist und jedes Ziel erreicht sein muss – im Gegensatz zu zyklischen Vorstellungen, wie etwa der des Hinduismus, spannt sich unser Leben als Bogen.
Ein zentraler Aspekt im Voranschreiten von einem Lebensalter zum nächsten, sind Krisen, zum Teil dramatische Umbrüche, die wir durchleben (sollten), wenn wir, etwa von der Zeit des reifen Erwachsenen zum Greis uns verändern; Dinge, die uns als Erwachsene selbstverständlich von der Hand gehen, müssen wir lernen, fahren zu lassen, lernen, anderen Platz zu machen; ob wir in Würde alt werden, liegt nicht zuletzt daran, ob wir in der Lage sind, diesen Schritt zu gehen oder, ob wir als unwürdige Greise, wie Aschenbach, der Protagonist des Tod in Venedig, versuchen, unser in Wahrheit verlorenes Jugendalter in Ewigkeit zu perpetuieren, als Gecken. Diese Krisen begründen die oben beschriebene Einteilung des Lebens in die Lebensalter.
Jedem Alter entspricht eine bestimmte Art, die Welt wahrzunehmen. Diese Wahrnehmung von der Welt entspricht wiederum eine bestimmte Art, sich durch Sprache auszudrücken. Kinder erleben die Welt sozusagen mystisch, alles Märchenhafte ist nicht, wie für Erwachsene am Rand des Kitsches, sondern wird als realer Teil der eigenen Welt wahrgenommen. Für Kinder sind Metaphern keine Umschreibungen der Wirklichkeit, sondern die Wirklichkeit selbst.
Hier verlassen wir Guardini, der den Gedanken der rhetorischen Figuren im Zusammenhang der Lebensalter nur ganz am Rande erwähnt und wechseln zweihundertfünzig Jahre früher nach Neapel. 1725 veröffentlichte Giambattista Vico seine Scienza Nuova, die Neue Wissenschaft, sein Philosophisches Hauptwerk. Vico hatte sich über viele Jahre mit der Geschichte auseinandergesetzt, vor allem der griechischen und römischen Antike und intensiv die Literatur dieser Zeiten studiert. Dabei war er auf eine bis dahin vollkommen unbeachtete Tatsache aufmerksam geworden: die von ihm untersuchten “Hochkulturen” waren über die Zeit nicht gleichförmig, sondern es erschien ihm eine Hierarchie der Epochen, ein “Erwachsenwerden”, “Altern” und schießlich “Vergehen” – Corso und Ricorso. Mit jedem dieser Zeitalter, so folgerte Vico, kommen ganz spezifische Eigenschaften der Kultur und Gesellschaft, in der die Menschen dieser Zeit leben, die man, ganz vergleichbar zu Guardinis Lebensaltern beschreiben könnte.
Vico war aber besonders eines aufgefallen: jede Epoche hat ganz bestimmte Tropen, die ihre Literatur und vermutlich ihr ganzes Denken prägen. Und daraus entwickelt er eine orginelle Systematik. In der frühesten Literatur einer Kultur drückt sich eine mystische Welterfahrung aus – alles wird durch Metaphern verkörpert. Götter lenken direkt das Schicksal in der Vorstellung der Menschen solch einer Zeit, bis sie schießlich durch Helden abgelöst werden, es sind jetzt Menschen, die das Schicksal bestimmten, aber ins unnatürliche überhöhte, legendäre Figuren. Die Umschreibung ist das Stilmittel der Literatur der Heldenzeit, die Metonymie. Schließlich folgt die eigentlich historische Epoche, Polis oder Republik, mit wirklichen Menschen als handelnde Subjekte. Juristische Texte und politische Reden machen jetzt einen Großteil der Literatur aus. Darin haben Metaphern oder Übertragungen kaum platz. Die Ironie ist die Trope des Menschen-Zeitalters. Danach geht es wieder abwärts – Kaiserzeit/Diktatur mit Heldenverehrung und schließlich Zerfall in die mystische Zeit der Völkerwanderung.
Vergleicht man Vico mit Guardini, so lieg nahe, die Zeitalter des einen mit den Lebensaltern des anderen zu verbinden – und man bekommt auch für jede Phase unseres Lebens eine passende rhetorische Figur. Kinder erfahren die Welt im Spiel. Wie in der Mystik, kann alles gleichzeitig das “normale Ding”, z.B. ein Brett und doch “etwas anderes”, z.B. ein Raumschiff sein. Es gibt für Kinder keinen Unterschied zwischen Sachbuch und Märchen. In der Jugend kommt die “Heldenverehrung”, die Überhöhung von Vorbildern, die Übertragung, die Übertreibung. Für Erwachsene ist alles machbar, wissenschaftlich, alles geregelt. Im gegenseitigen Umgang hilft die Ironie den Erwachsenen, distanz zur eignen Position zu zeigen, “ist alles nicht so ernst”. Mit schwindenden Kräften wächst im Alter das Gefühl von Unsicherheit. Sicherheitsbedürfnis, Fixierung auf feste Strukturen, das Bedürfnis nach starker “Führung” der als tendenziell bedrohlich empfundenen Gesellschaft sind die Folgen. Und schließlich können wir als Greise Wirklichkeit von Einbildung nicht mehr unterscheiden – es kommen die senile Paranoia, Depression, oder mystische “Altersweisheit”.
| Lebensalter |
Zeitalter |
Tropus |
| Kindheit |
Mystik |
Metapher |
| Jugend |
Helden |
Metonymie |
| Erwachsenenzeit |
Menschen |
Ironie |
| Alter |
Ricorso |
Metonymie |
| Senilität |
Zerfall |
Metapher |
Wie schon öfter angeführt, kann man unsere neuere Geschichte regelrecht als eine Folge von “Wendepunkten” in der Kommunikationskultur beschreiben. Als erstes beendet das Linguistic Turn das “finstere Mittelalter” des allegorischen Denkens, die “Kindheit” unserer Kultur. Der “Iconic Turn” hebt uns ins Zeitalter der globalen Massenkommunikation mit Ironie, um nicht zusagen Zynismus als Leitfigur. Und schließlich erleben wir gerade jetzt die nächste Wende, den Memetic Turn, bei dem wir wieder ins bildhafte zurückfallen. Diese “History of Turns” habe ich – wie gesagt – etwas ausführlicher in einem eigenen Post beschrieben: Memetic Turn.
***
Unsere Welt als unaufhaltsame Abfolge von Fort-Schritten, hat unterliegend etwas Trauriges. Man stirbt nämlich immer zu früh. Es gibt wohl so gut wie keine angenehme Art, aus dem Leben zu scheiden. Unerreichte Ziele, Dinge, die am Lebensende übrig bleiben, erscheinen uns sogar tragisch. So muss der Engel der Geschichte mit weit aufgerissenen Augen der zusehen, wie “eine einizige Katastrophe, unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert.”; Fortschritt als Abfolge von Tragödien. Statt aber uns über unser sicheres Ende zu grämen, empfehle ich jetzt, Nachman von Bretzow zu lesen, jenen großen Mystiker, der vor zweihundert Jahren in der heutigen Ukraine als chassidische Zaddik lehrte; sein moralisches Gebot: “Mitzvah gedolah le’hiyot besimcha tamid” – Es ist die große Weisheit, stets glücklich zu sein.
Weiterlesen:
Kohelet – Zeit und Glück
Michael Ende: Momo
Memetic Turn
Walter Benjamin: Über den Begriff der Geschichte IX