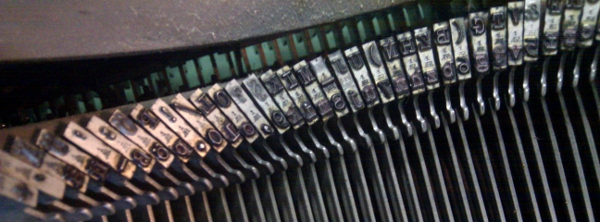“Ask any kid what Facebook is for and he’ll tell you it’s there to help him make friends. […] He has no idea the real purpose of the software, and the people coding it, is to monetize his relationships. He isn’t even aware of those people, the program, or their purpose. […]
The kids I celebrated in my early books as “digital natives” capable of seeing through all efforts of big media and marketing have actually proven *less* capable of discerning the integrity of the sources they read and the intentions of the programs they use.”
Douglas Rushkoff
Vilém Flusser hätte Google einen Apparat genannt, der funktional sehr einfach aber strukturell hoch komplex ist. Vor solchen Apparaten hatte uns Flusser stets gewarnt: sie zu beherrschen ist fast unmöglich – zuviel Spezialwissen aus unterschiedlichen Disziplinen ist dazu nötig; sich von ihnen beherrschen zu lassen dagegen ist ganz einfach: sie sind uns nützlich und für jeden leicht zugänglich – auch ohne Expertise.
Was für die Nutzung des Internets generell gilt, sollte uns für Google besonders wichtig sein. Im September haben laut ComScore knapp fünfzig Millionen Deutsche auf Google zugegriffen, das sind etwa 90 % der Online-Bevölkerung; jeder dieser fünfzig Millionen Besucher war dabei im Schnitt vierzig Mal auf den Google-Seiten. Und während die meisten Nutzer auf die Frage nach dem Existenz-Grund für Google wohl ähnlich auf den Nutzen beziehen würden, die sie sich selbst durch die Suchmaschine versprechen, wird doch spätestens bei der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse deutlich, dass Google unter allen Medien inzwischen wahrscheinlich der effizienteste Werbeträger ist – zumindest was Performance-Werbung betrifft.
Die Menschen hinter SEO und SEM haben Google genau in diesem Sinne verstehen gelernt. Und damit auch klar ist, worum es sich bei den Search-Experten handelt, gibt es eine schöne, bildhafte Einteilung in zwei Lager:
die Black Hats – die Bösewichte aus dem Western, die systematisch die Schwächen der Such-Algorithmen ausnutzen, die bei so komplexen Systemen unvermeidbar sind, und die White Hats, als die man in der IT-Praxis die Sicherheitsexperten, die “Guten” Hacker bezeichnet, die mit ihrem Wissen helfen sollen, Systeme zu stabilisieren.
Für uns Nutzer ist es aber tatsächlich egal, ob wir von einem düsteren Black Hat auf eine Seite gelotst werden, auf die wir gar nicht wollten, oder ob uns ein White Head, ein Angestellter einer “seriösen Search-Agentur” ein Suchergebnis nach oben optimiert wurde, das wir auch nicht bekommen wollten. Aber im Englischen kommt bei beiden Begriffen eine schöne Doppeldeutigkeit zum tragen: Blackhead und Whitehead – beides bedeutet Mitesser. Das heißt, auch bei den SEO-Profis, die sich vielleicht selbst als die Helden mit den weißen Hüten sehen möchten, kommt unweigerlich die Assoziazion von lästigen Hautunreinheiten.
“When human beings acquired language, we learned not just how to listen but how to speak. When we gained literacy, we learned not just how to read but how to write. And as we move into an increasingly digital reality, we must learn not just how to use programs but how to make them.
Digital tools are not like rakes, steam engines, or even automobiles that we can drive with little understanding of how they work. Digital technology doesn’t merely convey our bodies, but ourselves.
At the very least we must come to recognize the biases – the tendencies- of the technologies we are using.”
schreibt Douglas Rushkoff weiter.
Digital Literacy – Medienkompetenz für Online-Medien – besteht nicht nur darin, zu Wissen wo und wie man relevante Informationen findet, es geht nicht nur darum, die Qualität von Quellen kritisch beurteilen zu können und auch nicht nur darum, mit persönlichen Daten sorgfältig umzugehen. Digital Literacy bedeutet zu allererst zu erkennen, welche Interessen im Netz wirken, auf welche Absichten verfolgen, bestimmte Dienste anzubieten und die technologischen Grundlagen dafür zu begreifen.
Und genaus, wie wir nicht nur hören sondern auch sprechen lernen, nicht nur lesen, sondern auch schreiben, wird das, was uns im Umgang mit Medien wirklich kompetent macht, erst erreicht, wenn wir nicht nur passive Nutzer sind, sondern aktiv eingreifen. Wir sollten alle – wenigstens in Grundzügen – die Fähigkeit besitzen, SEO zu machen. Wir sollten die Funktionsweise der Apparate für unsere Zwecke einsetzen, genau so, wie die Suchmaschinen-Optimierer dies tun, und zwar so gut wir können, unseren Teil vom Profit aus diesen Strukturen holen.
Oder wie Benedikt Köhler bemerkt: “Maschinen sind dazu da, uns zu dienen. Aus der Kultur der Hacker können die Medienmacher lernen: sich nicht den Maschinen unterordnen, sich genausowenig verweigern, sondern die Maschinen ausnutzen, ja regelrecht ausbeuten, versklaven!”
Gerade sitze ich in Schwechat. Es ist ein wunderschöner Herbsttag und auch gestern ist es mir wiedermal nicht besonders schwer gefallen, auf Suchmaschinen zu verzichten. Alles, was ich an Links gebraucht habe, um etwa diese Reise vorzubereiten, habe ich auf Wikipedia gefunden oder von Freunden empfohlen bekommen.
Weiterlesen:
“Das Heer der technischen Sklaven”
und die bisherigen Posts zum Experiment “Ohne Google”:
Die bisherigen Posts zum Experiment “Ohne Google”:
 [Read this post in English]
[Read this post in English]