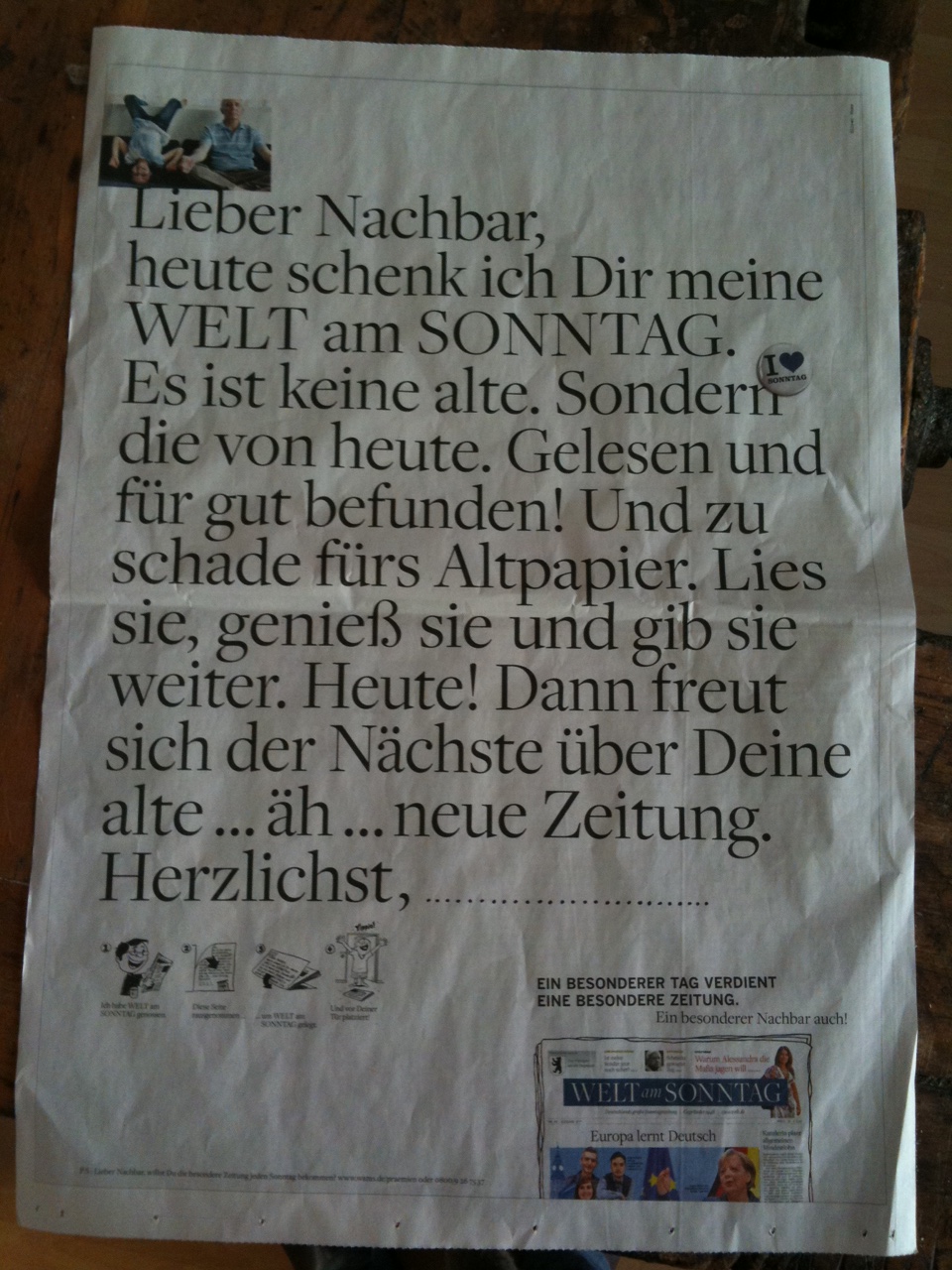_________________________________________________________________________________________________________________
[Dieser Beitrag erschien im UmweltWirtschaftForum 19 (2012), Springer-Verlag. Bitte nach Originalquelle zitieren, vollständige Quellenangabe und DOI s. u.]
_________________________________________________________________________________________________________________
Zusammenfassung
Diskursive Formate mit offenem, prozesshaftem Werkcharakter sind ein Kennzeichen unserer Zeit. Dieser Beitrag beleuchtet die Ursachen dieser Entwicklung und zeigt an konkreten Praxisbeispielen, wie dieses Phänomen konstruktiv im Sinne einer strategischen Nachhaltigkeit bei Unternehmen und Medien eingesetzt werden kann. Kernaspekt ist das „nachhaltige Kommunizieren“, nicht das „Kommunizieren von Nachhaltigkeit“. Dieser Perspektive liegt ein ganzheitliches Verständnis zu Grunde, das den Begriff der Nachhaltigkeit als strategisches Querschnittsthema versteht, welches interne wie externe Kommunikation, Marketing wie Human Ressources gleichermaßen betrifft. Dabei geht es nicht um eine Idealisierung offener Strukturen und kollaborativer Werke und Vorgehensweisen, sondern um eine Analyse der Bedürfnisse, die deren Erfolge erklären, und um ein Verständnis der gesellschaftlichen Erfordernisse, im 21. Jahrhundert adäquat und medial nachhaltig zu agieren.
1 Einleitung
„Die strenge Grenze doch umgeht gefällig
Ein Wandelndes, das mit und um uns wandelt;“
(Goethe)
In seinem Essay „Opera Aperta“ („Das offene Kunstwerk“) skizziert Umberto Eco 1962 eine Poetik der Offenheit bei Schrift- und Kunstwerken (Eco 1962, Eco 1973). Er definiert sie im Gegensatz zur Poetik der Eindeutigkeit, die einer klaren gesellschaftlichen Ordnung entspringt. Wie die Allegorie des Mittelalters besteht das geschlossene Werk aus eindeutigen Chiffren mit enzyklopädisch festgelegten Bedeutungen, es hat eine definite Form und einen eindeutigen Sinn. Das „offene“ Kunstwerk hingegen ist nicht eindeutig, es ist mehrdeutig. Es ist nicht fertig, wenn es den Künstler verlässt. Es fordert den Rezipienten zum Auswählen und Neukombinieren von Bedeutung auf. Erst in der Rezeption vollendet sich das Werk des Künstlers.
Eco: „Der Künstler, so kann man sagen, bietet dem Interpretierenden ein zu vollendendes Werk: er weiß nicht genau, auf welche Weise das Werk zu Ende geführt werden kann, aber er weiß, daß das zu Ende geführte Werk immer noch sein Werk, nicht ein anderes sein wird, und daß am Ende des interpretativen Dialogs eine Form sich konkretisiert haben wird, die seine Form ist, auch wenn sie von einem anderen in einer Weise organisiert worden ist, die er nicht vorhersehen konnte“ (Eco 1973, 55).
Der „interpretierende Dialog“ ist konstituierender Bestandteil des Werkes. „Das Werk ist […] offen, so wie eine Diskussion dies sein kann: die Lösung wird erwartet und erhofft, muß aber aus der bewußten Mitarbeit des Publikums hervorgehen“ (Eco 1973, 41), so schreibt Eco in Bezug auf Brechts Theater.
Umberto Eco geht 1962 von einem in seiner Geste zwar offenen, seiner Kontur nach aber noch recht klaren Werk aus. Noch waren es der Künstler, der Autor, der Komponist, die die äußere Kontur und Gestalt des Werkes bestimmten. Als Unterkategorie der „offenen“ Kunstwerke führt Eco das „Kunstwerk in Bewegung“ (Eco 1973, 42) ein – sie haben die Fähigkeit, „verschiedene, unvorhergesehene, physisch noch nicht realisierte Strukturen anzunehmen“ (Eco 1973, 42).[1] Der Betrachter ist „an der Erschaffung des ästhetischen [S. 166] Objektes beteiligt“ (Eco 1973, 43), das Kunstwerk hat eine „dynamische Struktur“. Hier fängt der Werkurheber an, das Hoheitsrecht auf die letztendliche Werkkontur an den Rezipienten abzugeben. Allerdings bewegt sich dies noch im Möglichkeitsraum, den der Künstler für sein Werk vorgesehen – und vorgegeben – hat. Im Fazit des Aufsatzes konstatiert Eco: „Die Poetik des Kunstwerks in Bewegung instauriert (so wie teilweise die des „offenen“ Kunstwerks) einen neuen Typ der Beziehung zwischen Künstler und Publikum, […] eine andersartige Stellung des Kunstproduktes in der Gesellschaft“ (Eco 1973, 59). Künstler und Publikum arbeiten zwar Hand in Hand an einem gemeinsamen Werk – aber sie sind noch von einander unterscheidbare Instanzen.
2 Offene Werke heute
Diese Entwicklung hin zu einer Offenheit der Werke ist seitdem rasant fortgeschritten. Zum Jahrtausendwechsel entstanden parallel in verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten und Anwendungsbereichen Werke, deren strukturelle Offenheit die von Umberto Eco skizzierte bei weitem übertreffen. Diese offenen Werke aus unterschiedlichen Bereichen der Medien, Kommunikation, Politik, Wirtschaft und Technologie (interessanterweise gerade nicht Werke der Kunst, von denen ja Eco ausging), entfalten eine erstaunliche gesellschaftliche Wucht und habe Auswirkungen auf bestehende wirtschaftliche und mediale Strukturen.
2.1 Kathedrale und Basar
Auf dem vierten Internationalen Linux-Kongress 1997 trug der Programmierer Eric S. Raymond seinen Essay „The Cathedral and the Bazaar“[2] (Raymond 1997a) vor. Darin schildert er die Eigenschaften zweier gegensätzlicher Konzepte zur Entwicklung von Computer Software. Zum einen das Prinzip der Kathedrale, bei dem IT-Unternehmen unternehmensinterne Programmierer eine Software entwickeln lassen, die dann als proprietäre Software vertrieben wird, ohne dem Anwender Einblick in den Quellcode zu erlauben. Die Produktentwicklung verläuft in Stufen, mit Entwicklungssprüngen zwischen den einzelnen Produktveröffentlichungen.
Anders beim Prinzip des „Basars“: Bei Open-Source-Software ist der Quellcode eines Computerprogramms über alle Entwicklungszeiträume hinweg frei zugänglich. Anwender können den Quellcode, das Bauprinzip, verwenden, selbst weiterentwickeln, Fehler beheben und Funktionen ergänzen. Die Entwicklung verläuft nicht in Stufen, sondern ist im Fluss und kann sich Erfordernissen des Anwendungsumfelds agil anpassen. Open Source Software ist nie „fertig“, sondern immer auf dem Wege der weiteren Verbesserung und Anpassung, sie ist ein lernendes System. Die Software befindet sich in einer immerwährenden Test- und Entwicklungsphase, „permanent beta“[3] ist ihr eingeschrieben. Punkt sieben der von Raymond in Kathedrale und Basar aufgestellten „Guidelines for creating good open source software“ lautet: „Release early. Release often. And listen to your customers.” (Raymond 1997b).
In wenigen Jahren schafften es diese kollaborativ entwickelten Software-Programme, zur Stabilität zu reifen und zu einem wahrnehmbaren wirtschaftlichen Faktor zu werden. Bereits 2006 wurde der Gesamtwert aller ausgereiften Open Source-Lösungen in einer Studie der EU (Flossimpact 2006) auf 12 Milliarden Euro geschätzt. Dies bedeutet, dass ein Unternehmen soviel Geld aufwenden müsste, um diese Programme inhouse produzieren zu lassen. Die Menge an frei verfügbaren Codezeilen verdoppelt sich in 1 bis 2-Jahresintervallen. Open Source Software ist ein offenes Werk, ein digitales Werk in Bewegung. Die Anwender vollenden das Werk nicht nur durch ihre Rezeption, sondern indem sie aktiv in das Werk eingreifen. Die Programme werden nicht im Labor oder am Reißbrett, sondern in der Anwendung im Alltag und entlang der Kundenerfordernisse weiterentwickelt.
2.2 Eine Enzyklopädie als offenes Werk
2001 wurde die Online-Enzyklopädie Wikipedia gegründet. Bereits vorher gab es einige Projekte, die eine kollaborative Enzyklopädie zum Ziel hatten. Ein Erfolg wurde dieses Vorhaben erst mit dem Einsatz der Wiki-Engine, einer Software, die das dezentrale Bearbeiten von Inhalten direkt im Internetbrowser ermöglichte. Wikipedia-Artikel werden von einzelnen oder mehreren Autoren konzipiert, geschrieben und gemeinschaftlich überarbeitet, korrigiert und weiterentwickelt. Auch wenn viele Beiträge zunächst von einem einzelnen Autor verfasst werden, sind sie doch das Ergebnis und Zeugnis einer sozialen Interaktion, von Überarbeitungen, zum Teil scharfen Auseinandersetzungen und Filterprozessen. Konsequenterweise liest sich die Richtlinie für Wikipedia-Autoren, die „Wikiquette“ (Wikipedia-Wiki 2011) im Gegensatz zu gängigen Autorenrichtlinien wie die Hausordnung einer Wohngemeinschaft – sie regelt nicht nur die formalen Abläufe, sondern den Umgang der Autoren untereinander. Wikipedia-Beitrage sind offene Werke, sie sind das Ergebnis einer sozialen Handlung unter den Autoren und Lesern, und über diese zugleich ständig im [S. 167] Austausch mit ihrer Umwelt, mit dem Geschehen der Welt. (ZEIT 2011a).[4] Politische Ereignisse, neue Forschungserkenntnisse und Perspektiven finden unmittelbar, zum Teil binnen Minuten, über die betreuenden Autoren Eingang in die Beiträge – nicht erst in der nächsten durch Druckauflagen bestimmten Entwicklungsstufe wie in traditionellen Enzyklopädien. Die Online-Enzyklopädie passt sich nahezu in Echtzeit der Welt an, der Welt durch den Filter der Wahrnehmung ihrer Autoren. In kaum zehn Jahren hat es Wikipedia mit ihrer dynamischen Struktur geschafft, Ikonen der statischen Schrift- und Druckkultur wie der Brockhaus Enzyklopädie und der Encyclopædia Britannica den Rang abzulaufen.
2.3 Eine Partei mit offener Struktur
Parteiprogramme, Kommissionen, Gremien und Ausschüsse regeln die Struktur von politischen Parteien. Der Wunsch nach Identität und Stabilität in der politischen Arbeit drückt sich in Fraktionsdisziplin und in der verlässlichen Zuordnung in politische Lager aus. Die 2006 gegründete Partei der Piraten versucht, einen strukturell anderen Weg zu gehen. Längere Zeit agierte die Partei ohne klares Parteiprogramm. Ein Grundsatzprogramm wurde erst in aufwendigen Austauschprozessen über offene Kommunikationsplattformen mit den Parteimitgliedern entwickelt. Als das Parteiprogramm von der Partei beschlossen wurde, war sein Entstehungsprozess noch nicht beendet, es hatte noch keine endgültige Form. Es ist mithin das erste Parteiprogramm, das beschlossen wurde, ohne fertig zu sein. Wir beschließen es jetzt, welche Form es hat, legen wir später fest, schien die Devise. Inzwischen ist das Parteiprogramm von der Beta-Phase in das „Release“-Stadium übergegangen. Auf der entsprechenden Seite des „Piratenwikis“ (Piratenwiki 2011), das sonst auch Besuchern Mitarbeit erlaubt, heißt es: „Dieser Artikel ist eine offizielle Aussage der Piratenpartei und daher gesperrt. Willst Du etwas ändern, so musst entweder den Verantwortlichen für diese Seite ansprechen oder gar einen Änderungsantrag auf dem nächsten Parteitag stellen“. Die Partei versucht, ihre Identität zu finden und zugleich offen zu bleiben – eine schwierige Gratwanderung, wie sich erst kürzlich mit der vorübergehenden Sperrung des „Piratenpads“, einer weiteren offenen Kommunikationsplattform gezeigt hat. Nachdem externe Nutzer auf der Piratenplattform zweifelhafte Links veröffentlicht hatten, musste die Seite vorübergehend vom Netz genommen werden. Parteichef Sebastian Nerz räumte in diesem Zusammenhang ein, „dass es keine absolute Sicherheit gebe: „Offene Strukturen können immer missbraucht werden.““ (Heise 2011).[5]
Der Beweis, ob Parteien und Politik überhaupt funktionieren können, wenn sie sich in dieser Weise als offene Struktur verstehen, ist noch nicht angetreten. Als signifikantes Phänomen unserer Epoche, als Zeichen der Zeit im Sinne Ecos, ist es jedoch bedeutsam. (Eco 1973, 45).[6]
3 Veränderung ist der Zustand
Im ersten Jahrzehnt dieses Jahrtausends ist das Phänomen des diskursiven Formats mit offenen Strukturen zunehmend zu beobachten. Aus Mehrdeutigkeit ist Mehrgestaltigkeit geworden, aus Offenheit der Rezeption Offenheit der Form. In einem radikalen, konsequenten Schritt nehmen die „offene Diskussion“ und der „interpretierende Dialog“, von denen Eco spricht, selbst Gestalt an und prägen die Form des Werkes. Das Werk wird formal Abbild einer sozialen Interaktion, gibt selbst Zeugnis ab vom Austausch mit der Umwelt. Urheber und Rezipient des Werkes sind immer weniger zu trennen.
Die entgegengesetzten Pole proprietärer Software und Open-Source-Software sowie der Brockhaus-Enzyklopädie und der Online-Enzyklopädie Wikipedia entsprechen im Bereich der Online-Kommunikation dem Verhältnis von statischen Websiten zu Blogs mit dynamischen Inhalten und auf wirtschaftlicher Ebene dem Wechsel vom „Produkt“ zur „Dienstleistung“.
Diese gesellschaftlichen und medialen Phänomene schreiben zum einen die bereits von Umberto Eco festgestellte Entwicklung hin zu offenen Werken fort. Zum anderen erfüllen sie ein zentrales Erfordernis unserer Zeit: die strukturelle Abbildung von Veränderung und das Bedürfnis nach nachhaltiger und substantieller Kommunikation, die trotz schneller Veränderung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen Nachwirkung und Bestand hat.
1995, lange bevor das Internet und die digitalen Technologien tief in der Gesellschaft verwurzelt waren, trafen sich auf der Konferenz “E-PUB 95” siebzig Verleger und Verlagsmanager, um „Neue Wege zum Leser“ zu erörtern. Ein Artikel in der „Zeit“ (ZEIT 1995) zitiert den Verleger Michael Urban mit den Worten: „Früher hatten wir einen Zustand, dann kam eine Veränderung, dann ein neuer Zustand. Jetzt ist Veränderung der Zustand.“
Geradezu paradigmatisch formuliert Urban hiermit die Erfordernisse der Zeit: Eine Form zur Abbildung und Bewältigung eines Zustandes zu finden, der ein Zustand konstanter [S. 168] Veränderung ist. Hinter dem Erfolg offener Strukturen und diskursiver Formate, selbst wenn sie Experimente sind, steht der Wunsch nach Beständigkeit in einer flexiblen Form: Die Forderung nach nachhaltigen Strukturen und Formaten, die sich Veränderungen anpassen können, ohne durch den Wandel obsolet zu werden. Teile der Wirtschaft und der Industrie beantworten den Zustand der Veränderung mit immer rasanteren Produktzyklen und beschleunigten Halbwertzeiten. Die Entwicklungszeiträume zwischen Produkt und Produkt werden immer kürzer, können jedoch mit der Veränderung der Rahmenbedingungen nicht Schritt halten. Was heute noch Geltung hat, ist morgen schon überholt. Es entsteht der zusätzliche Eindruck einer Beschleunigung. Was die Zeit aber fordert, ist nicht mehr desselben, sondern etwas strukturell Neues. „Werke in Bewegung“ sind eine mögliche Antwort auf konstante Veränderung.
Digitale Technologien stellen Strukturen und Techniken zur Verfügung, die geeignet sind, die Bedürfnisse nach Anpassungsfähigkeit und struktureller Nachhaltigkeit zu erfüllen – sie sind jedoch nicht der einzige Weg dorthin. Es ist wichtig, den digitalen Wandel nicht nur als Verursacher der gesellschaftlichen Veränderung zu sehen, sondern auch als ein Ergebnis gesellschaftlicher Erfordernisse – das wiederum seinerseits stark auf die Gesellschaft einwirkt.
4 Diskursive Formate als Element struktureller Nachhaltigkeit: Beispiele aus Unternehmen
Was bedeutet diese Entwicklung nun konkret für die Kommunikation von Unternehmen und für Medien? Welche Gestalt können diskursive Formate annehmen und welche Auswirkungen haben sie auf die Nachhaltigkeit von Unternehmen und Medien? Hier seien exemplarisch einige Formate genannt, die einen offenen, prozesshaften Werkbegriff pflegen, Veränderung strukturell abbilden und anpassungsfähig sind.
4.1 Wöchentlicher digitaler Bericht aus einer Print-Werkstatt
Unter der Rubrik „Ein Blick in die ZEIT“ stellt Chefredakteur Giovanni Di Lorenzo wöchentlich die aktuelle Printausgabe der ZEIT vor. Er tut dies auf dem Webportal ZEIT ONLINE und in Form eines Videos. Man sieht den Chefredakteur in seinem täglichen Arbeitsumfeld, auf seinem Schreibtisch liegen mehrere Titelentwürfe für die Printausgabe ausgebreitet (ZEIT 2010, ZEIT 2011c). Er berichtet, welche Geschichte sie als Titel geplant hatten, welche aktuellen Entwicklungen dazwischen gekommen sind und welche Titellayouts zur Auswahl stehen. Er berichtet nicht von einem fertigen Medien-Produkt, sondern von einem Werk im Prozess, auch mit allen offenen Fragen. Die ZEIT ermöglicht mit diesem Format jede Woche neu einen Blick hinter die Kulissen und vermittelt Verständnis für den Prozess der Entstehung einer klassischen Print-Wochenzeitung. Hier wird ein digitales Medium verwendet, um über ein Printmedium zu sprechen – auf eine Weise, die der Zeitung selbst nicht möglich gewesen wäre. Online- und Papier-Medium spielen hier konstruktiv Hand in Hand. Es ist ein digitales Medium mit bewegtem Bild, aber es verweist auf ein Print-Medium.
4.2 Entstehungsprozess einer iPad-App
Anfang 2010 beschloss die Tageszeitung DIE WELT, bereits zum Launch im Mai 2010 auf dem Apple-iPad präsent zu sein. Dies bedeutete einen kurzen Entwicklungszeitraum und mangels Geräten eine eingeschränkte Testphase. Die iPad-App wurde deshalb von Anfang an bewusst als ein Produkt definiert, das in Zusammenarbeit mit den Lesern und Nutzern weiterentwickelt werden sollte. Das Produkt war da, aber es befand sich erst am Anfang eines Prozesses der Verbesserung und Optimierung. Es war ein Produkt „in Bewegung“. Erst die Leser machten mit ihrer Nutzung und Rückmeldung das Produkt zu dem, was es heute ist, halfen, Ideen zu priorisieren und Nutzerfreundlichkeit herzustellen. Die Erfahrung mit der offenen Leser-Kommunikation war aus Sicht des Verlages rundum positiv.[7] Voraussetzung bei solchen Vorhaben ist es, sich selbst als ein lernendes System zu verstehen und in wirklichen – auch kritischen – Austausch mit dem Nutzer zu gehen. Die iPad-App ist zwar ein digitales Medium, die prozesshafte Werkentstehung in Rückkopplung mit dem Leser/Nutzer ist aber auch auf andere Medienformate übertragbar.
4.3 Die mitwachsende Rubrik „Was wurde aus“
In der Kategorie „Online-Extras“ führt das Internetportal des Wirtschaftsmagazins „brand eins“ eine Rubrik namens „Was wurde aus“ (brandeins 2011a). Hier werden Themen und Berichte, die vor einiger Zeit in der Print-Ausgabe veröffentlicht wurden, noch einmal aufgegriffen. So erfährt der Leser beispielsweise nach fünf Jahren den aktuellen Stand über den Verlauf des jahrelangen Rechtsstreits um den lizenzfreien Anbau der Kartoffelknolle „Linda“ (brandeins 2011b).
In einem ganzheitlichen Ansatz werden die Geschichten und Beiträge im Magazin als Teil einer größeren Geschichte gesehen, die nach dem Publizieren weitergeht. Auch Auseinandersetzungen und kritische Reaktionen werden nicht ausgespart (brandeins 2011c).[8] Dies entspricht dem Ansatz des Magazins, Nachwirkung zu erzielen, eine verlässliche [S. 169] und glaubwürdige Leserbindung aufzubauen und strukturell nachhaltig zu agieren (David 2010). Ähnliche Rubriken wären auch in nicht digitalen Medien denkbar, hier ist sie dem Online-Portal vorbehalten. Bestimmte Elemente ausschließlich online zu publizieren, entspricht einer ausgewogenen Verzahnung von Online und Print-Inhalten, in der sich digitale und nicht digitale Darreichungsformen ergänzen anstatt doppeln.
Die Anpassungsfähigkeit und Prozesshaftigkeit offener Werke findet sich wörtlich in der Titelzeile der Rubrik wieder: „Was wurde aus Unternehmen, Menschen, Projekten, Ideen, über die wir berichteten? Updates aus einem laufenden Prozess: Dem Leben.“ (brandeins 2011a).
4.4 Ein Corporate-Blog für Mitarbeiter
2007 startete mit dem „Daimler Blog“ das erste Corporate Blog eines DAX30-Unternehmens. Darin schreiben Mitarbeiter des Unternehmens über ihre Arbeit und zeichnen nach innen und außen ein lebendiges Bild eines Unternehmens in Bewegung. Hier wird nicht nur über abgeschlossene Projekte und fertige Produkte berichtet, sondern auch über laufende Prozesse. Gerade diese lassen auf besonders plastische Weise die Kultur und strategische Ausrichtung des Unternehmens sichtbar werden. Als Beispiel sei hier der Beitrag „Wem gehört das Auto der Zukunft?“ (Daimler 2009)[9] von Ann-Kathrin Knebel genannt. Als Mitglied der Business Innovation Plattform nahm sie an einem Strategieworkshop über die Zukunft der Mobilität teil. Thema war ein möglicher Wandel vom Besitz zur Nutzung von Autos und welche Konsequenzen eine solche Entwicklung für den Premium Automobilhersteller haben würde. „Natürlich haben andere und ich uns schon einige Gedanken zu diesem Thema gemacht, doch würde ich mich gerne hier im Blog mit Ihnen darüber austauschen und Ihre Anregungen mit in unseren Workshop nehmen“, schreibt sie in ihrem Beitrag, dem über 50 lebhafte Kommentare folgten.
Was das Unternehmen hier kommuniziert, ist nicht nur, welche Produkte es herstellt, sondern auch, wie es zu Lösungen kommt, und welche Unternehmenskultur es pflegt. Es wirkt nach innen identitätsstiftend und ist nach außen ein aussagekräftiges Signal für mögliche zukünftige Mitarbeiter. Damit wird das Corporate Blog zu einem wichtigen Instrument der Human Resources. Es bildet reaktionsschnell aktuelle Entwicklungen und Diskurse ab und ist ein nachhaltiger Resonanzraum für Unternehmenskultur.
5 Fazit
Für unsere Zeit gilt, was auch Umberto Eco für 1962 feststellte: „[E]s ist […] interessant, auf der Schwelle unserer Epoche einen so ausgeprägten Versuch in Richtung auf das Kunstwerk in Bewegung zu finden: ein Zeichen dafür, daß gewisse Bedürfnisse und Forderungen in der Luft liegen, sich durch die bloße Tatsache ihres Daseins rechtfertigen und als kulturelle Gegebenheiten zu erklären sind, die zum Bild der Epoche gehören.“ (Eco 1973, 45).
Offene Werke, diskursive Formate, kollaborative Entstehungsweisen und flexible Strukturen, die sich agil den wechselnden Bedingungen anpassen können, sind ein Kennzeichen unserer Zeit, sie gehören zum Bild unserer Epoche. Sie sind Zeichen für Bedürfnisse und Forderungen. Ihre gesellschaftliche Wirkung erklärt sich nicht allein daraus, dass sie technisch möglich sind – sondern daraus, dass sie Antworten auf die Fragen der Zeit anbieten. Dahinter steht der Wunsch nach Beständigkeit in einer flexiblen Form und nach nachhaltigen Strukturen. Die Skalierbarkeit bisheriger Mechanismen gerät an ihre Grenzen, wie sich an immer rasanteren Produktzyklen und beschleunigten Halbwertzeiten offenbart. Dies erfordert einen qualitativen Wechsel zu neuen Mechanismen, die besser geeignet sind, Veränderung strukturell abzubilden. Diese Forderungen und Bedürfnisse zu erkennen und mit adäquaten Formaten zu beantworten, ist die Aufgabe der Wirtschaft, der Unternehmenskommunikation und der Medien. Ob diese Formate digital sind, ist dabei sekundär – entscheidend sind vielmehr ihre diskursiven Eigenschaften und ihre Anpassungsfähigkeit. Diskursive Formate und ein offener, prozessorientierter Werkbegriff sind ein Beitrag zu strategischer Nachhaltigkeit, der die Anpassungsfähigkeit des Unternehmens fördert und strukturell verankert.
Literatur
brandeins (2011a) http://www.brandeins.de/online-extras/was-wurde-aus.html. Zugegriffen: 1. Dez. 2011
brandeins (2011b) http://www.brandeins.de/online-extras/was-wurde-aus/der-kartoffelsorte-linda.html. Zugegriffen: 1. Dez. 2011
brandeins (2011c) http://www.brandeins.de/online-extras/was-wurde-aus/manuel-frondel-und-seiner-berechnung-zur-solarstrom-foerderung.html. Zugegriffen: 1. Dez. 2011
Daimler (2009) Ann-Kathrin Knebel, Wem gehört das Auto der Zukunft? 25.06.2009, in: Daimler Blog http://blog.daimler.de/2009/06/25/wem-gehoert-das-auto-der-zukunft/. Zugegriffen: 1. Dez. 2011
David S (2010) Die brand eins. Slow Media Blog. https://www.slow-media.net/die-brand-eins. Zugegriffen: 1. Dez. 2011
Umberto Eco (1962) Opera Aperta, Bompiani, Mailand
Umberto Eco (1973) Das offene Kunstwerk, Suhrkamp, Frankfurt a. M.
Flossimpact EU (2006) Study on the: Economic impact of open source software on innovation and the competitiveness of the Information and Communication Technologies (ICT) sector in the EU. http://www.flossimpact.eu. Zugegriffen: 1. Dez. 2011
[S. 170]
Johann Wolfgang von Goethe: Urworte. Orphisch. TYXH, Das Zufällige, zitiert nach: Theodor Echtermeyer, Benno von Wiese (1956) Deutsche Gedichte, August Bagel, Düsseldorf, S. 221
Heise (2011) Oliver Diedrich, Piratenpad ist wieder online. Heise online. 27. Nov.2011 http://www.heise.de/newsticker/meldung/Piratenpad-ist-wieder-online-1385981.html
Piratenwiki (2011) http://wiki.piratenpartei.de/Parteiprogramm. Zugegriffen: 1. Dez. 2011
Raymond (1997a) http://www.catb.org/~esr/writings/cathedral-bazaar/cathedral-bazaar/. Zugegriffen: 1. Dez. 2011
Raymond (1997b) http://www.catb.org/~esr/writings/cathedral-bazaar/cathedral-bazaar/ar01s04.html. Zugegriffen: 1. Dez. 2011
Raymond E S (1999) The Cathedral & the Bazaar. O’Reilly, Sebastopol
Wikipedia-Wiki (2011) http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikiquette
ZEIT (1995) Dieter Brehde, Wo ist der Markt? DIE ZEIT, 23/1995. Digital abrufbar unter: http://www.zeit.de/1995/23/Wo_ist_der_Markt. Zugegriffen: 1. Dez. 2011
ZEIT (2010) http://www.zeit.de/administratives/2010-06/die-zeit. Zugegriffen: 1. Dez. 2011
ZEIT (2011a) http://www.zeit.de/themen/digital/wikipedia/index. Zugegriffen: 1. Dez. 2011
ZEIT (2011b) Patrick Beuth, PR-Agentur brüstet sich mit Manipulation von Wikipedia und Google. Zeit online. 08.12.2011 http://www.zeit.de/digital/internet/2011-12/bell-pottinger-wikipedia-manipulation/komplettansicht.
ZEIT (2011c) http://www.zeit.de/video/2011-12/1313466351001. Zugegriffen: 1. Dez. 2011
Fußnoten
[1] Als Beispiele nennt Eco Alexander Calders Mobiles, die auf Veränderungen der räumlichen Anordnung reagieren, und die Fakultät der Universität in Caracas, die als „jeden Tag neu zu erfindende Schule“ mit mobilen Wänden ihre innere Struktur den Umständen anpassen konnte (Eco 1973, 42).
[2] Es erschien zwei Jahre später als Buch (Raymond 1999) im Verlag von Tim O’Reilly, der wiederum 2006 in einem eigenen Essay den Begriff „Web 2.0“ aufgriff und prägte.
[3] Das Beta-Stadium ist die Phase, in der ein Softwareprodukt schon getestet, aber noch nicht abgeschlossen ist (Wikipedia 2011a).
[4] Einen plastischen Einblick in diese Werkstatt des Wissen gibt diese Echtzeit-Anwendung, die ZEIT online entwickelt hat (ZEIT 2011a). Sie zeigt im Liveticker im Moment editierte Artikel in der deutschsprachigen Wikipedia.
[5] Auch Wikipedia ist wegen der Offenheit des Systems immer wieder Ziel von Manipulationsversuchen von außen (ZEIT 2011b).
[6] Als „Zeichen dafür, dass gewisse Bedürfnisse und Forderungen in der Luft liegen“ (Eco 1973, 45).
[7] Quelle: Romanus Otte, General Manager WELT online.
[8] So wird zum Beispiel auf eine kritische Analyse des Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie hingewiesen, welche die Berechnung des „brandeins“-Autors Manuel Frondel zu den Kosten der Solarstromförderung relativiert (brandeins 2011c).
[9] Sie selbst antwortet dort auch auf die Kommentare, siehe Kommentar 46 (Daimler 2009).
___________________________________________________________________________________
Original-Quelle:
Sabria David: Diskursive Formate und ihre Rolle für mediale Nachhaltigkeit – Gedanken zu einer Poetik offener Werke. In: UmweltWirtschaftForum 19 (2012). Springer Berlin/Heidelberg. S. 165-170. DOI 10.1007/s00550-011-0227-7
http://www.springerlink.com/content/1354327876300245/
Die Seitenangaben der Druckausgabe finden Sie kursiv im laufenden Text.
(Verlinken dürft ihr natürlich)