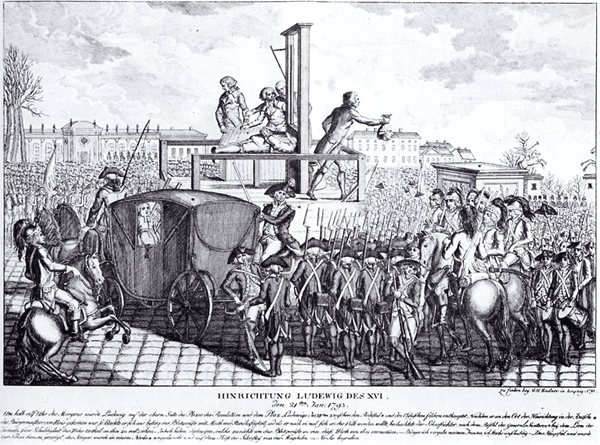Woran es liegt, weiß ich nicht. Aber auf diesem Blog ist Pierre Bourdieu bisher leider viel zu selten zu Sprache gekommen. Dabei sind seine Gedanken zum sozialen Feld, Kapitalsorten und Distinktion wie geschaffen für die Analyse von Slow. Ist die Lebenszeit nicht auch eine Art Kapital, die man gegen andere eintauschen kann? Bedeutet Slow dann nicht auch, sein Zeitkapital für wertvoller zu halten als sein ökonomisches Kapital und der Versuchung zu widerstehen, kostbare Zeitbudgets für epikuräischen Genuss umzutauschen in Geld oder Einfluss?
Was mich gerade eben wieder zu Bourdieu gebracht hat, ist aber eine andere Idee. Er schreibt über Kunstwerke und Kulturproduktion, dass ihr primärer Zweck nicht der ästhetische Genuss ist, sondern dass die drei folgenden Distinktionsmechanismen für die soziale Hierarchie des guten Geschmacks viel entscheidender sind: erstens sind Ergebnisse der Kulturproduktion immer an bestimmte soziale Klassen gerichtet und leisten also auch Beihilfe zur Definition der Klasse. Zweitens grenzen sie diese von anderen Klassen ab und drittens dienen sie als Ausweis der Mitgliedschaft zu dieser. Der Künstler und der Connoisseur bedienen sich dieser Mittel um eine exklusive, hierarchische und stabil reproduzierbare Hierarchie der Kultur zu etablieren. Ein wichtiger Punkt dabei: die Unterschiede müssen rein gehalten werden, die Klassen müssen anhand ihrer kulturellen Codes jederzeit sauber voneinander getrennt werden können: Donaldisten ins Töpfchen, Leser von Lustigen Taschenbüchern ins Kröpfchen.
Vor fünf Jahren hatte ich mit einer Archäologie der Blogosphäre begonnen und habe versucht, die frühesten Schichten dieser Sphäre auszugraben – also die Trojas I bis X der digitalen Literatur und ihre Genealogien zu entdecken. Eines der Ergebnisse ist dieser Zeitstrahl der deutschen Blogosphäre. Was an den frühen Blogs fasziniert, ist die intensive Verwendung von Links. Kein Post ohne Links, waren doch die ersten Ur-Blogs der mittleren digitalen Bronzezeit doch nichts anderes als kommentierte Linklisten. Der Gestus des Bloggers erinnert dabei an die Ethnologen des 19./20. Jahrhunderts. Sehet, welche merkwürdigen Dinge ich in den endlosen Weiten des Internets gefunden habe.
Links sind dabei auf den ersten Blick nichts anderes als kulturelle Querverweise oder Zitate. Die Blogosphäre kann man auch als eine globale Zitationsgemeinde sehen. Insofern, könnt man meinen, gefundenes Fressen für die oben beschriebene kulturelle distinction Bourdieuscher Art. So wie man in der Partitur von Schoenberg Zitate von Strauss findet, entdeckt man auch immer mehr Verweise zwischen den digitalen Kulturprodukten. Mit einem entscheidenden Unterschied: die digitalen Verweise sind maschinenlesbar. Mit der geeigneten Software – mein Code dafür hieß Metaroll – lässt sich der auf den ersten Blick esoterische Zusammenhang zwischen Blogs und Bloggerinnen restlos entschlüsseln. Der Algorithmus erkennt in Sekunden, wer eng befreundet ist, wer inhaltlich auf einer Linie ist und welche Blogger in ihren eigenen isolierten Parallelwelten leben und schreiben. Das war mit der alten Kultur nicht möglich (wird aber womöglich auch nicht mehr lange dauern).
Zum Entschlüsseln des farbenfrohen Referenzentangos der Blogosphären-Eingeboren muss man kein Feldforscher sein, ja nicht einmal ein armchair anthropologist. Diese Aufgabe kann sogar ein Roboter erledigen. Alles Wissen darüber liegt dem Onliner mit den geeigneten Werkzeugen zu Füßen. Das bedeutet aber nicht weniger, als dass die Blogosphäre sich nicht zur kulturellen Distinktion eignet. Sie ist nicht das Habitat des Connaisseurs, sondern des kulturellen Allesfressers. Dass gegen Jahresende 2012 Bloggerinnen und Blogger wie Johnny Häusler, Jens Best oder Claudia Klinger wiederentdecken, was für ein subversives Instrument sie mit der Blogosphäre bedienen können (oder könnten), ist gut. Noch besser, wenn die Blogosphäre sich im Zuge dieser Renaissance auch wieder an die wichtige Funktion des maschinenlesbaren Links erinnern würden: als Gegenmittel gegen kulturellen Standesdünkel und Distinktionsgewinnler. Überlasst die Blogosphäre nicht den Connaisseuren.
[Dieser Blogpost wurde auf einem Eee PC 900 verfasst, einem Netbook aus der Blütezeit der Blogosphäre]