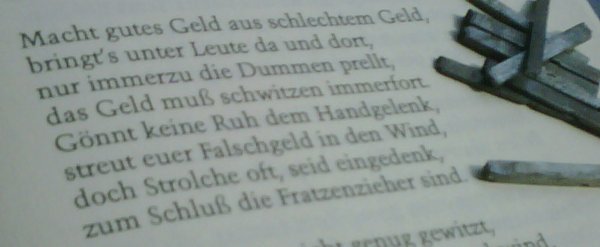Ich habe neulich über Twitter einen Hinweis auf einen Artikel der Financial Times Deutschland bekommen: Bernd Oswald schreibt dort über den “PR-Journalismus im digitalen Zeitalter”. In dem Beitrag wird der Eindruck vermittelt, dass das Medium Internet zu einer unseligen Verflechtung von PR und Journalismus geführt habe, von Unternehmensinteressen und öffentlicher Berichterstattung. Diese Aussage kann ich so nicht gelten lassen. Im Gegenteil handelt es sich bei der Vermischung von PR und Journalismus um eine ungebrochene Tradition, die mit dem Erscheinen der Online-Medien am Publikationshorizont nichts zu tun hat. Zu Beginn der 90er Jahre war es jedenfalls Gang und Gäbe und keinesfalls unüblich, dem Publikationswunsch eines Pressetextes bei der Redaktion mit dem Hinweis auf die Anzeigenabteilung Nachdruck zu verleihen. Vom Internet war damals noch weit und breit nichts zu sehen. Die Personalausstattung der Redaktionen war schon zu dieser Zeit so ausgelegt, dass ein gewisser Prozentsatz an externen, aus der PR stammenden Beiträgen durchaus einkalkuliert war. Man könnte meinen, dass sich dieses Problem nun erledigt habe (keine Anzeigenkunden, keine Interessenskonflikte), aber so ist es – noch – nicht.
Als Beispiel für die Interessensvermischung durch das Digitale führt der Beitrag Richard Gutjahrs Berichterstattung von der iPad-Premiere an: “PR-Journalismus reinsten Wassers” (diese Formulierung stammt nicht von Oswald selbst, sondern von Thomas Leif, dem Vorsitzenden des Netzwerks Recherche). Und hierin besteht meiner Meinung nach ein Missverständnis. Die Frage lautet: Ist es – und unter welchen Umständen – journalistisch legitim, positive Berichte über Unternehmen und ihre Produkte zu machen? Wann ist es glaubwürdig, wann ist es ein Interessenskonflikt? Wie subjektiv darf ein Journalist sein? Ist es “Selbstvermarktung, Aushöhlung journalistischer Standards und […] reine Werbung”, wenn ein Jounalist sich 24 Stunden lang in New York in die iPad-Warteschlage einreiht und von dort aus live per Twitter, Blog und Printbeiträgen berichtet? Die Fragen sind interessant und führen zu Haltungs-Unterschieden im Print- und Online-Journalismus.
Darf ich mich zum Beispiel als Autorin des Wirtschaftsmagazins brand eins noch positiv über sie äußern? Ist es ein Interessenskonflikt, wenn wir als Slow Media Autoren die brand eins als Prototyp erfolgreicher Slow Media darstellen? Darf ich das? Meine Antwort hierauf lautet: Ja. Weil ich selbst weiß, wie die Reihenfolge ist: Meine Haltung zu brand eins war schon vorher da, nur deshalb bin ich überhaupt dort Autorin geworden. Wenn ich sie nicht für ein beeindruckendes Qualitätsmedium gehalten hätte, hätte ich ihr nicht als erstem Publikatinsmedium meinen Twitter-Beitrag angeboten. Ergo wäre ich nicht brandeins-Autorin geworden. Ich handle und schreibe nach meiner (vielleicht fehlbaren aber) wirklichen Überzeugung.
Eine ähnliche Haltung unterstelle ich auch bei Richard Gutjahr, wenn er zur iPad-Premiere nach New York reist. War er schon vorher überzeugter, erklärter und offener Apple-Addict? Ja (zumindest nach dem Eindruck, den ich von ihm über längere Zeit über Twitter und seinen Blog gewonnen habe). Ist es unglaubwürdig, wenn er dann nach New York fährt und davon berichtet? Eher nein. Macht es ihn käuflich? Möglicherweise, vielleicht auch nicht. Die Handlung wäre jedenfalls nicht mit einem beliebigen anderen Event, dem Launch eines xy-Produktes austauschbar.
Wie also definieren wir Glaubwürdigkeit? Ich denke, Glaubwürdigkeit ist da, wenn Stimmigkeit zu dem sonstigen Handeln und Schreiben besteht. Das setzt zwei Dinge voraus: Der Mensch und seine Haltung müssen hinter der Reportage, den Zeilen, dem Podcast sichtbar werden (dies ist übrigens These 14 unseres Slow Media Manifestes). Und die Leser müssen mehrere Beiträge desselben Autors gelesen haben, um ihn überhaupt einschätzen zu können. Das verlangt eine Bindung zwischen Lesern und Schreibenden, die ich dem Journalismus in Zukunft wünsche, ob nun print oder online.
Neulich habe ich einen Anruf im Auftrag einer namhaften überregionalen Print-Tageszeitung aus großem Verlagshaus erhalten. Es ging um ein “Themenspecial”, in dem wir mit unserer Agentur eine Anzeige schalten sollten. Neben dem Anzeigenplatz wird unverhohlen der redaktionelle Teil der Qualitätszeitung mitverkauft: “1/3 Seite neutraler Fachbeitrag in dieser Ausgabe, der aus Ihren Themenvorschlägen von unserem Autor für Sie erstellt wird”, so lautet es im Angebot. Ich bin nicht naiv. Ich weiß, dass das Realität ist. Trotzdem irriert es mich, dass mein Gesprächspartner nicht einmal merkte, wie absurd es ist, Geld zu zahlen, um sich dann im redaktionellen Teil als Expertin für authentische Kommunikation zu präsentieren. Ich habe Mitleid mit den Autoren, die diese Texte schreiben und am Ausverkauf des Journalismus mitwirken müssen. Natürlich spürt man in solchen Texten nicht mehr den Menschen, der sie schreibt. “Entfremdung” ist das Wort, das mir dazu einfällt als jemand, der selber schreibt. Es geht nur noch um die Schaffung anzeigenfreundlicher redaktionellen Umfelder. Ob es um das Thema “Knochen und Gelenke”, “Versicherungen” oder “Kommunikation der Zukunft” geht, ist völlig egal. Der journalistische Text (für den ich noch immer mütterliche Gefühle hege) wird hier zur völlig austauschbaren Ware.
“Selbstvermarktung, Aushöhlung journalistischer Standards” – hier sehe ich sie tatsächlich. Die Zukunft des Journalismus kann so etwas nicht sein. Das rettet einen Verlag höchstens über die nächsten Jahre. Vielleicht wäre es jetzt die Aufgabe für den Journalismus, sich zwischen den Polen der Entfremdung und der Subjektivität einen neuen Ort zu suchen.
Nachtrag (10. November 2010):
Gerade sehe ich ein sehr interessantes Interview mit Chris Anderson, dem Chefredakteur der Wired (über die wir hier bereits berichtet haben).
Er stellt folgendes fest (und das schließt hervorragend an die obigen Ausführungen über Redaktions/Anzeigen-Interessensverquickung an): Im 20. Jahrhundert haben die Zeitschriften/Zeitungsverlage die Frage “Who is my customer?” de facto mit: “the advertiser” beantwortet (bzw. beantworten müssen). Da stellt Anderson nun einen Wandel fest: Die Finanzierung läuft inzwischen zu gleichen Teilen über Anzeigenkunden und Leserschaft. Dadurch rückt der Leser plötzlich in den Fokus: “Going forward if my customer becomes my reader I am going to do the right thing for the reader – because it improves my profit.” Dass Publikatinsmedien ihre Leser zukünftig als ihre Kunden betrachten könnten, das finde ich eine ganz wunderbare Aussicht. “It’s the most exciting time in media ever.” Und auch hier muss ich ihm zustimmen.

 Ein tiefgreifender kulturelle Wandel führt dazu, dass die Zeitungen schneller in ihrer Bedeutung schwinden, als andere Massenmedien; darüber ist schon sehr viel gesagt worden. Solche Albernheiten, wie die Medienkompetenz-Brochure der Verleger werden daran nichts ändern. Aber sie machen mir die Entscheidung leichter, meine Kinder ohne Zeitung aufwachsen zu lassen.
Ein tiefgreifender kulturelle Wandel führt dazu, dass die Zeitungen schneller in ihrer Bedeutung schwinden, als andere Massenmedien; darüber ist schon sehr viel gesagt worden. Solche Albernheiten, wie die Medienkompetenz-Brochure der Verleger werden daran nichts ändern. Aber sie machen mir die Entscheidung leichter, meine Kinder ohne Zeitung aufwachsen zu lassen.

 [Read this post in English]
[Read this post in English]