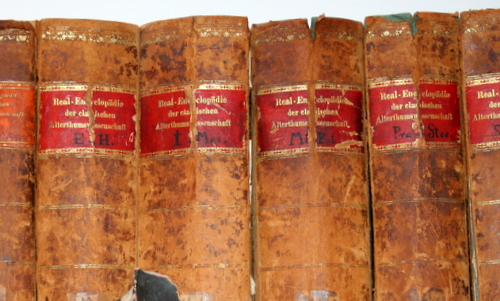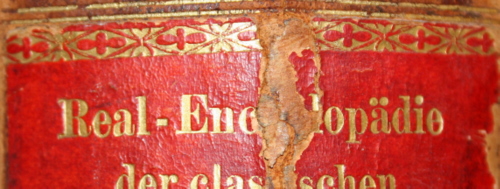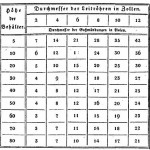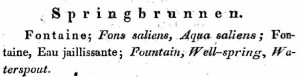Was konnte er dafür, daß er in der Literatur sein ganzes Leben lang ›nur‹ Verleger gewesen war? Er hatte begriffen, daß die Literatur einen Verleger nötig hatte, und er hatte das sehr zur rechten Zeit begriffen; dafür sei ihm Ehre und Ruhm – natürlich von der Art, wie es einem Verleger zukommt.
(F.M. Dostojewski)
Online-Journalismus? Ich habe diese Bindestrich-Journalismen sowieso nie so richtig verstanden, aber mit Online-Journalismus (Wikipedia: “Aufbauprinzip ist der nicht-lineare Hypertext” tue ich mich besonders schwer. Geht es um Online als Werkzeug für die journalistische Recherche oder redaktionelle Abläufe oder um Online als Gattung? Auf dem 6. Frankfurter Tag des Online-Journalismus bin ich auf beide Strömungen gestoßen. Ich glaube, dass etwas mehr Klarheit in dieser Unterscheidung für den Online-Journalismus (wie auch immer gemeint) wichtig wäre.
 So plätscherte das Abschlusspodium zwischen Jakob Augstein (Der Freitag), Mercedes Bunz (Guardian), Stephan Baumann (DFKI) und mir eher beschaulich vor sich hin, ohne dass das Diskussionspotential dieser Fragen genutzt wurde. Zum Beispiel für die Klärung der Frage, ob das Thema Blogger vs. Journalisten heute noch relevant sei. Hier wurde munter durcheinander und aneinander vorbei von Bloggern als Persönlichkeiten, Bloggen als Erwerbsquelle, Blogs als Publikationstechnologie und Blogposts als journalistische Form gesprochen.
So plätscherte das Abschlusspodium zwischen Jakob Augstein (Der Freitag), Mercedes Bunz (Guardian), Stephan Baumann (DFKI) und mir eher beschaulich vor sich hin, ohne dass das Diskussionspotential dieser Fragen genutzt wurde. Zum Beispiel für die Klärung der Frage, ob das Thema Blogger vs. Journalisten heute noch relevant sei. Hier wurde munter durcheinander und aneinander vorbei von Bloggern als Persönlichkeiten, Bloggen als Erwerbsquelle, Blogs als Publikationstechnologie und Blogposts als journalistische Form gesprochen.
Welche Funktion werden Verlage in Zukunft ausüben?
Für mich die spannendste Frage blieb leider unbeantwortet: Welche Funktion werden Verlage in Zukunft ausüben? Der klassische Verlagsbegriff sieht seit der frühen Neuzeit die Aufgabe des Verlegers darin, finanzielle Mittel und Rohstoffe wie Werkzeuge herbeizuschaffen (= “verlegen”), die für die Produktion einer Ware notwendig sind – ganz gleich ob es sich dabei um einen Teppich oder ein Buch handelt. Mit dem Aufkommen der industriellen Massengesellschaft bzw. Aufmerksamkeitsökonomie und der Zuspitzen des Verlagsbegriffs auf die Medienproduktion wurde dann der zweite Aspekt der Herstellung von Aufmerksamkeit für das Medium hinzu.
Wenn wir heute von digitalen Medien wie z.B. Blogs oder eBooks sprechen, passt die klassische Verlagsdefinition nicht mehr. Die Werkzeuge und Rohstoffe der Medienproduktion sind mittlerweile demokratisiert. WordPress und Mediawiki sind frei verfügbar. Jeder könnte also theoretisch publizistisch tätig werden. Viele tun genau dies. Auch für das Herstellen von Aufmerksamkeit kann die Verlagswelt kein Monopol mehr beanspruchen, da zunehmend die Empfehlung innerhalb sozialer Netzwerke bzw. einer themenbezogenen Community für die Rezeption eines Mediums wichtiger ist als klassische Marketingmaßnahmen. Buchbesprechungen in Zeitungen und das Auslegen von Flyern haben keinen nennenswerten Effekt auf den Absatz mehr, während Marketinginstrumente wie AdWords oder Suchmaschinenoptimierung Verlagen wie unabhängigen Publizisten gleichermaßen zur Verfügung stehen.

Wo also liegt heute noch die Aufgabe des Verlags? Auf dem Podium rückte ziemlich schnell der Aspekt der Finanzierung in den Mittelpunkt. So betonte Mercedes Bunz, dass guter Journalismus eben Geld koste und dafür brauche es einen Verlag. Ein Modell wie Wikipedia funktioniere nicht für den Journalismus. Diese Argumentation ist aus einer Slow-Media-Perspektive ebenso empirisch falsch wie politisch gefährlich.
Zum einen gibt es genügend Beispiele von Blogs, Foren oder Wikis, die außerhalb von Verlagen qualitativ hochwertigen Journalismus in Form von Kommentaren, Essays, Berichten etc. produzieren. Viel problematischer ist jedoch der andere Punkt. Wenn Verlage und Redakteure sich auf die Argumentation einlassen, dass die wichtigste Aufgabe des Verlags im digitalen Zeitalter in der Finanzierung von Journalismus liege, dann sehe ich keinen zwingenden Grund, warum die Medienlandschaft überhaupt noch Verlage braucht. Diese Aufgabe könnten auch Banken erledigen.
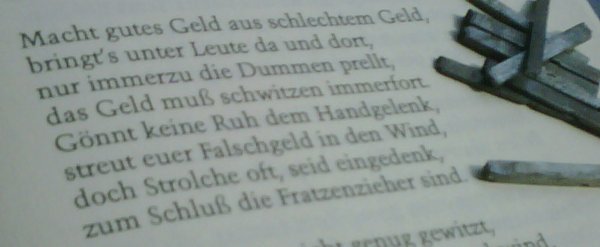
Wem daran liegt, dass Verlage auch in Zukunft noch eine Bedeutung haben sollen, der sollte sich nicht auf diese Argumentation einlassen und etwas mehr Phantasie bemühen, wenn es um die verlegerische Selbstbeschreibung geht. Wenn man gute, langsame Medien wie z.B. Wired, Brand eins oder Intelligent Life ansieht, dann machen die Verlage und Redakteure hier so unglaublich viel mehr als ihre Journalisten finanziell über Wasser zu halten. Sie diskutieren und setzen Themen, verbinden Design und Inhalt, arbeiten Ausgabe für Ausgabe am roten Faden ihres Mediums, garantieren ein hohes Qualitätsniveau und entwickeln ein Gespür für die Wünsche wie Erwartungen ihrer Leser. Dafür benötigt man Verlage heute wie in Zukunft und nicht allein für das regelmäßige Auszahlen des Taschengelds an ihre Mitarbeiter.
An diesen Stellen entsteht auch der Mehrwert zwischen den Gedanken im Kopf eines Autors und dem fertigen Produkt. Verlage, die ihrem Publikum nicht glaubhaft demonstrieren können, dass sie mehrwertfähig sind, haben nicht nur ein Kommunikationsproblem, sondern sind früher oder später in ihrer Existenz bedroht. Und das zu Recht.
Links zum Thema:
- Videoaufzeichnungen aller Vorträge auf der Webseite des Hessischen Rundfunks
- Mein Gastbeitrag “Lob der Langsamkeit” im Börsenblatt zu einem ganz ähnlichen Thema.
- Zusammenfassender Blogpost von Matthias Gutjahr






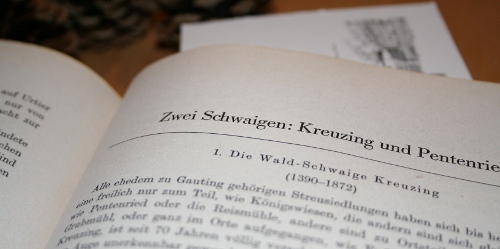





 [Read this post in English]
[Read this post in English]