Drei Bücher, die ich ganz dringend zum Lesen empfehle:
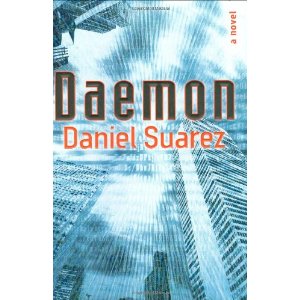
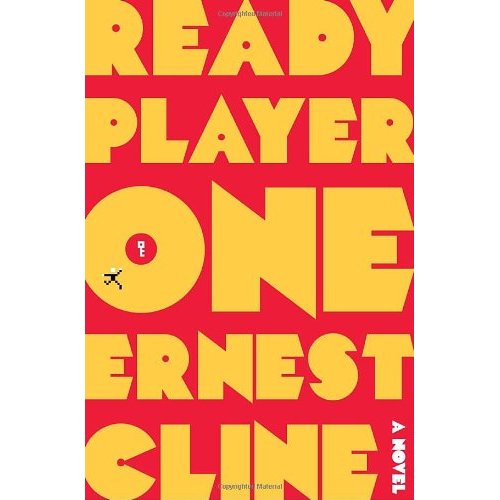
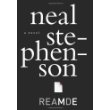
“Deamon” von Daniel Suarez
“Ready Player One” von Ernest Cline
“REAMDE” von Neal Stephenson
Alle drei im Abstand weniger Monate erschienen – für Literatur also praktisch gleichzeitig. Alle drei haben ein Thema: die “Subkultur”, die man, mangels besseren Begriffs, meist als Netz-Kultur bezeichnet, bricht sich Bahn in die “alte” Welt.
An der Oberfläche entwirft Suarez einen düsteren Verschwörungsthriller nahe am Science Fiction , bei dem die Welt durch ein dezentrales Darknet beherrscht wird. Stephenson bedient ebenfalls das bekannte Genre des “Wir-reisen-um-die-Welt”-Krimis – bei ihm löst ein nerviger Trojaner, mit dem Kleinkriminelle Lösegeld für verlorene Daten erpressen, beinahe ein zweites 9/11 aus. Und bei Cline gewinnt ein armer Junge durch seine Überlegenheit im Online-Gaming ein Milliardenvermögen. Alles also erstmal ganz konventionelle Thriller, mal mehr, mal weniger dazuerfundene Technologie.
Aber dieser konventionelle Rahmen für die Handlung ist, glaube ich, nur Zugeständnis an die Masse der Leser, denn das, was in allen drei Romanen darunter geschildert wird, ist wirklich epochal: das bisherige Macht-System der Welt implodiert.
Das Netz ist für die Helden aller drei Bücher die eigentliche Topografie der Welt. Macht, Geld, Wissen und Beziehungen organisieren sich entlang der Kanten und Knoten des Social Graph. Auch wenn die Schurken zum Teil genauso Net-Savvy sind, wie die Guten – den wirklichen Schaden richten die Anderen an, die Politiker, Polizisten und “Zivilisten”, die nicht vom Netz verstehen und deshalb die Helden und deren Gegner in einen Topf werfen und bekämpfen. In allen drei Büchern widerfährt am Ende den Netz-Underdogs endlich Gerechtigkeit. Ihr Talent wird gewürdigt und ihre elitäre Stellung in der Gesellschaft anerkannt – oder noch mehr: dass es die Hacker sind, auf die es in Wahrheit in der Welt ankommt. Und ich muss zugeben, dass ich beim Lesen ein hohes Maß an Identifikation mit den Protagonisten entwickelt habe, geradezu Stolz, dass “es endlich so weit ist” …
Clines “Ready Player One” ist für mich das beste der drei Bücher. Mag sein, dass mich die poetische Aufarbeitung einer Kindheit in den 80er Jahren und der sehr originelle Durchgang durch die frühe Atari- und Comodore-Kultur berührt, weil es ja auch meine Kindheit war und weil die Dystopie einer Post-Finanzkrisen-Welt der Zukunft dazu besonders scharf und traurig im Kontrast steht.
***
Nachdem ich mich durch alle drei Wälzer mit insgesamt ca. 2000 Seiten gefressen habe, frage ich mich, ob ich mir wirlich wünschen soll, dass meine Generation endlich Rache nimmt, an den Altdenkern, den Netzhassern, diese Diktuphoben. Bei allem Zorn auf die bornierte Netzverweigerung, über die wir uns täglich rauf und runter auf Twitter erhitzen: wenn die drei Bücher einen utopischen Entwurf vermitteln, dann ist dabei ganz schön viel von dem, was mir wichtig ist, überbord gegangen.
Bedrückend empfinde ich, wie wenig Platz für Frauen in diesen Büchern ist. Den Sieg tragen immer Machos davon, die in ihrer regelrecht archaischen Geschlechterrolle als Warrior/Mage krass zu den “weichlichen” Netzfeinden kontrastieren. Am krassesten bei ‘Daemon’, wo die neue Führungselite direkt aus Fightclub entlehnt scheint. Irgendwie ist kein Platz mehr für Philosophie, Psychologie – von Religion ganz zu schweigen, die sowieso das erste Opfer des harten Positivismus dieser neuen Welt so werden scheint.
Diesen Verlust so deutlich zu machen, ist für mich eine der stärksten Aspekte der drei Bücher. Und obwohl ich fest daran glaube, dass wir in der Netz-Kultur vieles vorbereitet haben, was für eine bessere Gesellschaft zum allgemeinen Gesetz werden kann und sollte, sehe ich auch, dass der Wechsel wohl nicht ohne Preis vonstatten geht. Und dabei meine ich nicht, dass wir keine Briefe mehr schreiben.
Amazon Links:
“Daemon” von Daniel Suarez
“Ready Player One” von Ernest Cline
“REAMDE” von Neal Stephenson
Weiterlesen:
Die digitale Kluft
Memetic Turn
Die Moderne ist unsere Antike
 [Read this post in English]
[Read this post in English]




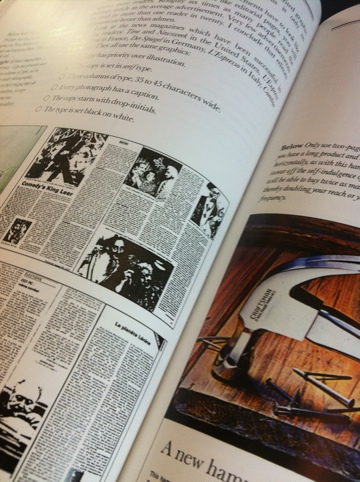
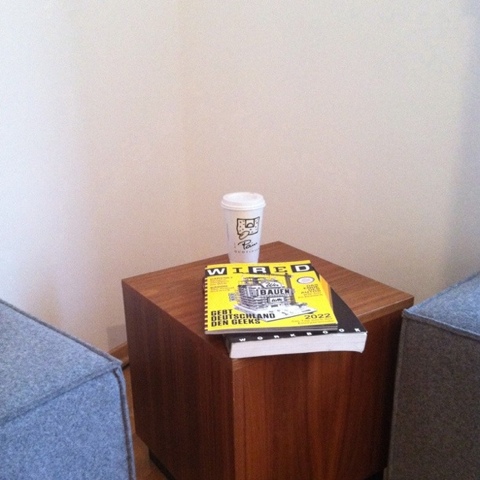



 Oft angesprochen auf die Macht der Computer sagte Konrad Zuse: Wenn die Computer zu mächtig werden, dann zieht den Stecker aus der Steckdose.
Oft angesprochen auf die Macht der Computer sagte Konrad Zuse: Wenn die Computer zu mächtig werden, dann zieht den Stecker aus der Steckdose.