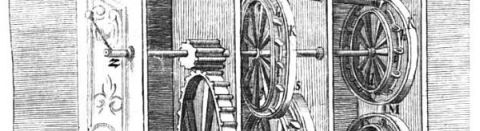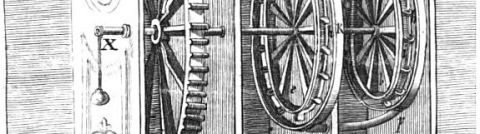———————————————————————————————————–
——– Original-Nachricht ——–
Betreff: instinktgetrieben
Datum: 22.02.2011 16:11
Von: Sabria David
An: Jörg Blumtritt
CC: Benedikt Köhler
Ich kann nicht anders, musste wieder einen blogpost schreiben. Ich möchte ihn aber nicht publizieren, bevor du ihn gelesen hast, Jörg:
>>>>>
“Augen zu und durch?
Auch wenn sich Zuschauer und Leser manchmal gestört fühlen – ohne Werbung geht es nicht”, lese ich gerade. Mit diesem Satz beginnt eine Art Grundsatzerklärung des Nachrichtensenders n-tv auf seinem Webportal n-tv.de. Sie seien zu 100% werbefinanziert, schreiben sie dort, und daher auf Werbeeinnahmen angewiesen. Das klingt zunächst wie ein fairer Deal. Bei genauerer Betrachtung allerdings ist es ein Deal ausschließlich zwischen dem Werbetreibenden und dem Werbesendenden. Welche Rolle spielt in diesem Deal aber der Nutzer, der Betrachter, die Zielperson – also: wir?
“Trotzdem soll die Werbung natürlich nicht nerven – obwohl eine Entwicklung in Richtung TV zu beobachten ist: Werbeformen, denen man sich nicht mehr entziehen soll und kann.”
Unser Unwillen gegen Belästigung wird zwar respektiert (“soll natürlich nicht nerven”), muss aber dem höhen Zweck weichen. Werbung ist die Kröte, die wir schlucken müssen, um uns die kostspieligen Fernseh/Web/Print/Inhalte zu verdienen. “Wenn Sie unsere Seite nutzen wollen, sollten Sie auch unser Geschäftsmodell akzeptieren: Die Finanzierung durch Werbeeinnahmen.”
Das bedeutet: Der Fairness halber sollen wir uns der Werbung nicht entziehen, obwohl sie uns nervt. Die Augen dürfen wir schließen, nur wegzappen bitte nicht. Wir sollen, so werden wir freundlich gebeten, bei dem Spiel mitspielen und einfach so tun, als würde sie uns interessieren.
Tun wir dies nicht, sind wir Spielverderber: “Den Einsatz von Software zum Ausblenden bzw. Unterdrücken von Werbung können und wollen wir nicht unterstützen.” Und weiter: “Natürlich können wir den Einsatz [von Werbeblockern] nicht verbieten. Das gilt aber auch für Schwarzfahren […] Es ist eine Frage des guten Benehmens, auf den Einsatz von Werbeblockern zu verzichten.”
Das Sich-Belästigt-Fühlen des Nutzers wird so zur moralischen Frage. Der Nutzer stört das System, er ist das Sandkorn im ansonsten rund laufenden Werbetreibendengetriebe.
Sollte es aber – so frage ich mich – nicht andersherum sein? Sollten wir aus dem Vorhandensein von Nachfrage nach Werbeblockern nicht schließen, dass etwas in dieser Kette falsch läuft? Und anfangen, nach den Ursachen dafür zu suchen? Als ein teuer produziertes notwendiges Übel hat die Werbung keine Zukunft, da bin ich mir sicher.
Alle Zitate aus: http://www.n-tv.de/faq/Werbung-muss-sein-article6112.html
>>>>>
(hab ihn extra nicht so geschrieben wie er auch hätte sein können, ihr könnt das zwischen den Zeilen mitlesen…)
LG
Sabria
——————————————————————————————————————
>>>
>>> Am 22.02.2011 18:51, schrieb Joerg Blumtritt:
Ja, danke für die Möglichkeit zum “Review”!
>>>>
Tatsächlich bin ich nicht deiner Meinung, obwohl ich den Beitrag sehr gern gelesen habe und ihn auch unterhaltsam finde.
>>>>
Zunächst finde ich die n-tv-Brochure tatsächlich total bescheuert; da gibt es keinen Zweifel; tollpatschig und unangemessen.
>>>>
Die ethische Aussage, dass zum Besuch der Seite die Wahrnehmung und Akzeptanz der Werbung gehört, finde ich aber vollkommen richtig. Damit bei den TV-Sendern auf den (relativ) knappen Frequenzen Werbung und Programm ein ausgewogenes Verhältnis halten, gibt es ein ausgesprochen scharfes Werberecht (im Rundfunkstaatsvertrag und der EU-Richtlinie fixiert). Dadurch wird Werbung auf max. 15% der Tages-Sendezeit bzw. max. 20% der Sendezeit in einer einzelnen Stunde beschränkt. Acht Minuten Werbung pro Stunde finde ich nicht inakzeptabel. Und im Netz, wo es ja keinerlei Monopolstruktur im Contentbereich gibt: welches Erlösmodell sollten journalistische Seiten sonst wählen? Es gibt die Wahl:
>>>> – Steuern oder Gebühren (d. h. Staats-Journalismus)
>>>> – Kostenpflichtig (wäre wünschenswert, hat sich bisher nirgends als praktikabel gezeigt)
>>>> – kostenlos und ohne Geschäftsmodell (nur etwas für den dilettantischen Schwärmer bzw. für Leute mit klarer Agenda dahinter)
>>>> – kostenlos und werbefinanziert
Das letzte Modell, dass sich ja durchaus über ca. 100 Jahre hinweg bewährt hatte, ist tatsächlich (genau wie Nr. 2) stark unter Druck.
Warum sollte ich mir die Werbung ansehen, wenn ich die Wahl habe? Der ehemals ausreichend starke Kleinanzeigenmarkt, der als eigener Content die Nachrichtenprodukte wie Zeitungen attraktiv gemacht hatte, ist weg – das greifen reine Portalseiten ohne jeden eigenen Content ab; da bleibt also nur noch die sog. Displaywerbung oder Werbeformate wie Corporate Publishing oder Sponsoring.
>>>>
Ich bin hier vollkommen derselben Meinung wie Jaron Lanier in “You are not a gadget”: Welche Wahl haben (und hatten) die Publisher?
>>>>
Ich bin auch der festen Überzeugung, dass der Wandel, der zu den Schwierigkeiten im Geschäftsmodell der Publisher führt, nichts mit deren Produkten zu tun hat, sondern viel tiefer in den meisten Kulturen unserer Welt stattfindet. Wenn das stimmt, ist es zwar richtig, dass die alte Form des Publishing zunehmend weniger wichtig wird, aber für die Zeit, in der es noch Content-Häuser wie die RTL-Group gibt, die schließlich mehr als 3000 Menschen alleine in Deutschland beschäftigen, ist es deren gutes Recht, ihr Geschäft nach besten Kräften zu stabilisieren. Ich finde, wir können den Weg, auf dem sie das versuchen kritisieren, indem wir zeigen, wie es anders vielleicht erfolgreicher funktionieren würde; wir sollten aber nicht einfach sagen: “euer Geschäftsmodell ist sowieso durch, deshalb lasst es am besten gleich sein”. Das wäre unangemessen sarkastisch.
>>>>
Und im konkreten Fall: ich finde auch Schwarzfahren unangemessen und ich zahle auch GEZ-Gebühren, obwohl die ÖR-Anstalten das erste sind, dass ich abschaffen würde, wenn ich die Macht dazu hätte. Aber ich akzeptiere den gesellschaftlichen Konsens, dass wir diese Form von TV noch brauchen und setze mich nicht darüber.
>>>>
Die Haltung der Piratenpartei in vielen Fragen ist dagegen: selbstverständlich Schwarzfahren; es ist Sache der Allgemeinheit, eine Allmende-Infrastruktur zu finanzieren und nicht die des Individuums, dazu einen Einzelbeitrag über die direkten Steuern hinaus zu leisten.
Ähnlich läuft auch das Argument gegen Urheberrecht und pro Grundeinkommen sowie gegen die MwSt. Dieses “Bezahlt mich gefälligst aus Steuermitteln” ist, was mich so besonders nervt. Dafür bin ich wohl zu liberal eingestellt.
Ich finde daher, wir könnten die Sache differenzierter darstellen – zunehmender Druck auf der einen Seite, immer mehr Möglichkeiten zur Vermeidung auf der anderen Seite, komplette Offenheit und Ehrlichkeit beim Geschäftsmodell (wird ja alles explizit gesagt), und eine nicht-triviale ethische Frage nach Gemeingut vs. Produkt, die ich auch in dem Post “Non-Commodity-Production” angerissen habe (insb. in der Tetrade “Decay of Copyright”. Vielleicht könnten wir das in Art eines elektischen Dialogs machen, der aus den beiden Thesen zu einer übergeordneten Synthese führt?
>>>>
Schöne Grüße
jb
>>>>
—————————————————————————————————————
>> Am 22.02.2011 23:32, schrieb Sabria David:
>>>
Lieber Jörg,
>>>
ich muss erst noch mal genauer darüber nachdenken, wo genau die Unterschiede ein unseren Ansichten sind. So weit liegen sie glaube ich gar nicht auseinander.
Du siehst es aus der Perspektive der Vermarkter und aus der der Publisher, die natürlich ein Recht auf ein funktionierendes Geschäftsmodell haben und vom Idealismus allein nicht leben können.
Meine Perspektive ist eher die des Werbenden und die des Kunden. Ich gehe nicht soweit, der Werbung ihre Existenzberechtigung abzusprechen.
Nur frage ich mich, welchen Sinn Werbung haben soll, von der man vorher schon weiß, das der Nutzer sie als Belästigung empfindet. Nur dass sie platzier- und verkaufbar ist und damit den Publisher (und die Werbeagenturen) finanziert, kann meines Erachtens nicht reichen. Das Werbetreiben ist ja kein Selbstzweck. Ich bezweifle, dass ein Nutzer durch eine ihn belästigende Werbeplatzierung dazu motiviert wird, dem werbenden Unternehmen gegenüber wohlgesonnen zu sein oder sein Produkt zu erwerben. Und das sollte ja das Ziel sein. Ich verstehe nicht, wie man als Werbetreibender damit zufrieden sein kann, dass meine Werbung den Kunden belästigt. Das Geld kann ich mir dann doch sparen oder einfach nur mein Logo einblenden – das nervt wenigstens nicht. (jetzt kann man natürlich sagen: alle beglücken kann man nie – mache drei zu glücklichen Kunden und nehme dafür in Kauf, 7 andere zu nerven…). Ein weites Feld.
Vielleicht finden wir ja eine Form, die die Positionen abbildet. Wie gesagt, muss noch nachdenken.
Herzlich
Sabria
(wie diskursiv wir wieder sind : -)
>>>
—————————————————————————————————————–
>
> Am 23.02.2011 09:57, schrieb Joerg Blumtritt:
>>
Sehr schön. Weiter im Dialog:
>>
Für den Werbekunden spielt lediglich eines eine Rolle: die Wirkung der Werbung in Abhängigkeit vom gesetzten Ziel. Es ist seit den 1960er Jahren über unzählige Studien bekannt, dass Werbung in Radio und TV umso besser wirkt, je stärker sie auffällt oder sogar stört. Damit handeln auch die Marken, die entsprechend werben, nicht unvernünftig.
Auch in der Konkurrenz um die Aufmerksamkeit am Regalplatz hat sich der “Störer”, wie die Werbeform sogar explizit heißt, seit Jahrzehnten bewährt. Aufkleber auf den Verpackungen, die eine bestimmte Eigenschaft (z. B. einen vergünstigten Preis, eine besondere Bewertung der Stiftung Wahrentest etc.) aus dem stimmigen Package-Design schrill herausheben, führen immer zu deutlich höheren Verkäufen.
>>
Allerdings – auch das ist lange bekannt, wirkt Schock-Werbung oder Werbung mit Negativ-Aussagen nicht (die Leute können sich zwar gut daran erinnern, “erschrocken” zu sein, aber die konkrete Botschaft, Markenerinnerung etc. ist dann in der Regel sehr schlecht, was sich wahrnehmungspsychologisch gut erklären lässt). Die Kunst der Display-, Anzeigen-, TV-Werbung liegt darin, stark genug aufzufallen, ohne einen Schock zu erzeugen.
>>
Der Wirkmechanismus, der für TV, Print, Radio und für klassische Online-Seiten definitiv stimmt, ist allerdings für Social Media nicht übertragbar. Hier ist die Situation vielleicht eher vergleichbar mit einem Restaurant-Besuch, wo man zwar gerne etwas vom Kellner oder von anderen, die das Restaurant schon kennen, empfohlen bekommt, aber auf keinen Fall überredet werden möchte.
>>
Insofern ist es, denke ich, sinnvoll, “Advertising by Interuption” und “Advertising by Engagement” immer stark Umweltbezogen abzuwägen. In bestimmten Situationen ist es eben besser laut zu schreien, anstatt darauf zu warten, gefragt zu werden.
>>
—————————————————————————————————————-
Am 23.02.2011 10:45, schrieb sabria david:
>
Hübsch. Wir nähern uns, in weitem Schneckenkreise (bin gespannt wo wir landen).
>
Ich stelle in Abrede, dass die Studien heute (bzw. in Zukunft) dasselbe Ergebnis brächten. Das Störprinzip ist nicht unendlich nach oben skalierbar: Es funktioniert am Besten in einem Medienumfeld von drei Fernsehprogammen, einer Tages- und zwei Wochenzeitungen (wo man 1. nicht wegzappen/ausweichen kann und 2. noch Aufmerksamkeit genug hat, sie zu bemerken). Je mehr Medienrauschen hinzukommt, um so schwerer wird es, dieses Prinzip durchzuhalten (auch wenn es natürlich noch eine ganze Weile funktioniert).
Man sieht gut die derzeitigen logischen Konsequenzen: auf mehr Rauschen wird mit noch mehr Geräusch reagiert, um die anderen Geräusche zu übertönen. Die Störer werden lauter, fangen an zu blinken, herauszuspringen und Krach zu machen. Man muss mehr Energie aufwenden, um zu stören, um noch aufzufallen, sich im Wettbewerb der Reize durchzusetzen. Die Frage ist nur, ob man das tatsächlich mit noch MEHR am besten schafft oder eher mit weniger, dem RICHTIGEN und PASSENDEN, das nicht durch Lautstärke, sondern durch Treffsicherheit auffällt.
Das ist m.E. ein sehr slowes Thema, weil es auch einen qualitativen Wechsel einfordert statt einer rein quantitativen Steigerung. “Mehr desselben” wird ab demnächst nicht mehr funktionieren. Da wird man sich fragen müssen, wie man sich in Zukunft bei Nutzern durchsetzen können wird, die ja nicht zufällig immer mehr unter Reizüberflutung leiden.
>
Vielleicht mit so etwas wie slow advertising (slow communication ja sowieso). Ich lerne aber durch deine Ausführung, dass man tatsächlich klarer zwischen “advertising” (=Stören) und communication (=Kontaktaufnehmen) trennen sollte.
> Your turn.
> S
——————————————————————————————————————-
——– Original-Nachricht ——–
Betreff: Re: instinktgetrieben
Datum: Wed, 23 Feb 2011 17:49:26 +0100
Von: Joerg Blumtritt
An: sabria david
Aufschlussreich ist ja die Definition von Information in der Nachrichtentechnik: Information ist immer nur die Störung, eines ansonsten gleichmäßigen Zustands. “Ein Gedicht ist ein Alphabet in Unordnung” (Cocteau). In dem Moment, wo Störungen zu Rauschen werden, sind sie keine mehr.
Das Zeigen des Passenden für die, die es auch wirklich sehen wollen funktioniert gut bei Dingen, die nur wenige Menschen ansprechen. Bei Dingen des täglichen Bedarfs aber: wie den Passenden finden? – es sind nämlich so gut wie alle! Das ist die Stärke und Schwäche der Massenmedien, insbesondere von TV: sehr viele Menschen gleichmäßig gut erreichen.
Einfache Massenprodukte auf ein bestimmtes Profil zu targeten, lohnt sich einfach nicht, mal davon abgesehen, dass die Kriterien fehlen würden. Außerdem verlieren Marken, die unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Botschaften gegenübertreten schnell an Glaubwürdigkeit – zu oft ist man selbst in mehreren Rollen unterwegs, und wenn man dann einmal die Nachricht a) und dann wieder b) empfängt, denkt man unwillkürlich: die wollen mich doch nur um den Finger wickeln.
Einfache, konsistente Markenführung dagegen, spricht alle Menschen mit den selben Worten an und ist so vielleicht nicht jedermann sympathisch, zumindest aber ehrlich.
Damit kommt aber das Phänomen Störung im nachrichtentechnischen Sinn wieder zum tragen, weil die Botschaft sonst nicht gehört wird. Dabei ist das Störende, im Sinne der n-tv-Brochure gar nicht auf eine bestimmte Werbung bezogen, sondern bedeutet allgemein, dass neben dem redaktionellen Angebot noch ein zweiter Strang an Information läuft, eben die Werbung.
Es kann in den meisten Medien aber gar nicht zu einem “Immer lauter” kommen, weil sowohl die Fläche werberechtlich oder redaktionell klar begrenzt ist, die Bildsprache ihre Grenzen in der “guten Sittlichkeit” und dem UWG findet, und die Lautstärke technisch beschränkt bleibt. Es muss also, um eine wirksame Störung zu erreichen, mit subtileren Mitteln gearbeitet werden.
Gute Kreation heißt also: Stören ohne zu schreien, ohne zu schockieren – ohne zu ver-stören. Aber gut ist die Kreation nur, wenn die Botschaft wahrgenommen, verstanden und erinnert wird; sonst be-wirkt sie nämlich nichts.
———————————————————————————–
——– Original-Nachricht ——–
Betreff: Briefwechsel?
Datum: 2011/4/21
Von: Sabria David
An: Joerg Blumtritt
CC: Benedikt Köhler
Lieber Jörg,
sollen wir wie neulich angedacht unseren Werbe-Briefwechsel publizieren?
Was hältst du davon, @benedikt, das als neue Gattung auf slowmedia einzuführen? Vielleicht überfordert das die Leser, keine Ahnung. Es wäre aber schön diskursiv – und es würde die Diskussion am Ende ins Publikum öffnen.
Das Original habe ich nochmal angehängt.
Herzlich und vorösterlich
Sabria
————————————————————————-
Am 21.04.2011 22:21, schrieb Benedikt Koehler:
>
Da kann man nur sagen: Hach! Was für wunderbare Dialoge entstehen, wenn man euch einmal für ein paar Augenblicke den diskursiven Rücke zuwendet.
So viele Anschlüsse! Dinge, die wir auch gerade erst vor kurzem diskutiert haben: Das Thema Rauschen / Signal hat die Werbung gewissenmaßen umkodiert in Umfeld / Werbebotschaft. Aber das faszinierende ist: Die Vorstellung von der Werbung als das Unterbrechende, Störende, Signalhafte ist immer schon zu kurz gegriffen gewesen. Gossage hat Werbeformen kreiert, die nur dann funktioniert haben, wenn man tatsächlich aktiv geworden ist. Oder denkt an Zeitschriften wie Vogue, Marie Claire etc. Das ist kein Umfeld, in dem Werbung platziert wird. Die Werbung ist selbst das Umfeld! Das ist eine Sache, die man auch bei Monocle immer wieder spürt. Da ist Werbung dabei, die man a) gar nicht als Unterbrechung empfindet und b) bei der man gar nicht enttäuscht oder wütend wird, wenn man am Ende herausfindet, dass das eine Marke “präsentiert” hat.
Deutlich wird das auch, wenn man nicht so sehr in klassischen Werbeträgern denkt, die eigentlich eine andere Botschaft aussprechen und die Marke sich nur Huckepack darauf setzt: Bandplakate, Konzertplakate, Filmplakate – alles Werbeformen, die Leute sich extra kaufen. In wie vielen Küchen hängen alte Persil- oder Coca-Cola-Werbungen? Was ist mit Schaufenstern, die für ein Ladengeschäft werben, aber auch am Sonntag von den Flaneuren betrachtet werden? Was ist mit den Passagen als Tempel des Konsums?
Werbung hatte immer schon das Potential mehr zu sein als Störung und Unterbrechung, als etwas was man notgedrungen akzeptieren muss. In Anlehnung an Gossage könnte man sagen: Werbung ist nach wie vor eine extrem kindische Kommunikationsform (= hier kannst du dich einklinken Jörg mit den Lebensalterstufen). Manchmal gibt es altkluge oder tatsächlich frühreife Ausnahmen. Aber der größte Teil funktioniert nach einem sehr kindlichen Schema. Nicht ohne Grund titeln Bücher über die Werbepsychologie z.B. “Haben-Wollen”. Unseren Job als Werber, die wir drei ja irgendwo sind, ist es eigentlich, erwachsene Werbung zu machen, die ihr Publikum ernst nimmt, die nachhaltig wirkt, die empfohlen wird … erinnert euch das an etwas? 😉
>
> Viele Grüße
> Benedikt
————————————————————————-
Am 21.04.2011 23:21, schrieb Sabria David:
> Hervorragend! Damit haben wir den vorläufigen Schlussakkord zu unserem Dialog – das einzige, was noch gefehlt hat (wenn wir das verwenden dürfen?). Auflösung im Trialog und Öffnung des Gesprächs nach draußen. Unschlagbar.
————————————————————————————-
Am 22.04.2011 12:48, schrieb Joerg Blumtritt:
> ja, wir sollten es veröffentlichen!