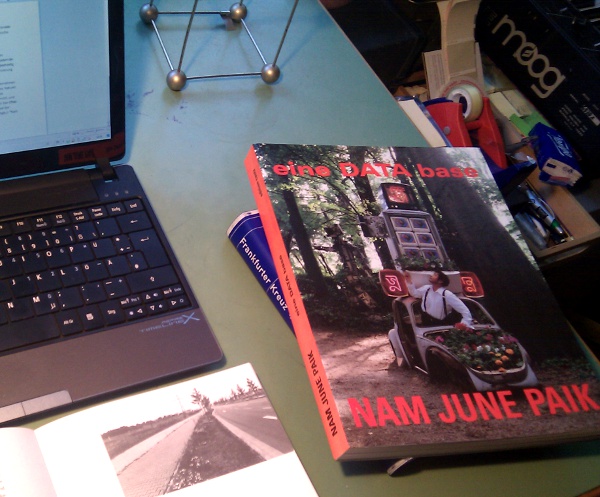Dec. 4 (Bloomberg) — PayPal Inc., the payment processor owned by EBay Inc., cut access today to the whistle-blowing website WikiLeaks.org for violating its acceptable use policy.
Anfang diesen Jahres wollte ich ein Buch bei einem Indischen Verlag bestellen. Als ich über den PayPal-Link auf der Verlagsseite bezahlen wollte, erhielt ich die Nachricht, das PayPal keinen Geldverkehr mit Indien mehr erlaube. Einfach so. Ohne irgendeine Begründung.
In der Diskussion um Google Streetview hat mich ein Argument besonders erstaunt: gegen Menschen, die ihre Häuser nicht für Googles Datenbank zur Verfügung stellen wollen, steht der Vorwurf, die seien “für Zensur”, gegen “die Freiheit des Internet” und ähnlich harte Anschuldigungen.
Die Wahrheit ist: Google, Facebook, Amazon, Ebay sind Wirtschaftsunternehmen. Der Umgang von Amazon und Ebay mit Wikileaks zeigt, welche Art von frei diese Firmen tatsächlich verkörpern: es ist frei wie in Freibier – und mit Freiheit hat es nichts zu tun, dass viele, bequeme Dienstleistungen von diesen Firmen scheinbar nichts kosten.
Es geht mir nicht um die Frage, inwieweit die Veröffentlichungen von Wikileaks schützenswert oder zu verdammen sind. Eine ethische oder politische Diskussion führen Amazon und Ebay nämlich nicht. Sie berufen sich auf ihre Allgemeinen Geschäftsbedignungen, die Wikileaks objektiv gebrochen hat.
Wenn wir den Googles, Facebooks, Amazons und Ebays dieser Welt das Internet überlassen, degradieren wir das Internet zu einer Manipulations- und Marketingmaschine. Jede Gesellschaft – ja sogar jede Gemeinschaft – sollte dafür sorgen, ihre wichtigen Inhalte und Schnittstellen nicht vollständig zu ökonomisieren. Regeln wie die Buchpreisbindung, das Pressegrosso und das Rundfunkrecht sind aus dieser Erkenntnis entstanden und haben sich in der “alten” Medienwelt über Jahrzehnte bewärt. Jetzt geht es darum, die Freiheit der Medien politisch und ethisch und nicht wirtschaftlich getrieben zu fördern.
Boykotte können helfen, Unternehmen zu erreichen – und sie zeigen uns im Verzicht auf die liebgewonnenen Services, wie abhängig wir tatsächlich schon sind. Aber zum Schluss wird es nur helfen, selbst für Alternativen zu sorgen.
Nachtrag: Zensur bei Twitter?
Eine besonders perfide – weil fast unmerkliche – Form von Einflussnahme von Twitter wurde spätestens jetzt am Beispiel Wikileaks deutlich.
Wikileaks wird aus den Trending Topics von Twitter gefiltert, wie mehrere Blogger heute quantitativ nachwiesen (z. B. http://bubbloy.wordpress.com), nachdem andere es bereits seit Tagen vermuteten.
Wenn solche Zensur bei der Verbreitung einzelner Tweets stattfindet, würden es vermutlich lange überhaupt niemand auffallen – die Betroffenen würden höchstens die bug-reiche API verantwortlich machen.
Wenn Twitter heute angeblich (und nach meinem dafürhalten tatsächlich) die einflussreichste journalistische Plattform ist, steht hier eine perfekte Maschinerie für Manipulation zur Verfügung, zumindest kurzfristig, bis im Ernstfall eine Alternative aufgetan worden wäre. Und richtig lustig wird es erst, wenn Twitter etwa anfangen sollte, im Namen politisch unliebsamer Accounts kompromitierende Nachrichten zu posten! (Und wer sollte sie daran hindern?)
Also – einmal mehr: raus aus den düsteren Walled Gardens und zurück ins helle, offene Netz!
Mehr zum Thema:
Virtueller Rundfunk
Digitale Zwangsneurosen
Zensur?!
Ohne Google
Der Idiot – wieder eine zeitgemäße Figur
 [Read this post in English]
[Read this post in English]